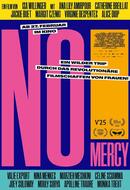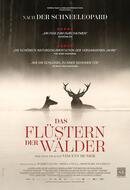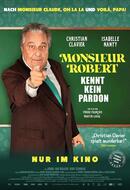The Rub – Kritik
Die Last der Sinnhaftigkeit – In dem Experimentalfilm The Rub wird eine mächtige Welle aus Farben, Linien und halb-verloschenen Bildern entfesselt, die dann aber vor den festen Rhythmen der Shakespeare’schen Bühnensprache schnell wieder verebbt.

Es ist das Schicksal jedes Films, dass er nicht einfach als eine Rolle Zelluloid oder als digitaler Datensatz in sich ruhen und nur für sich existieren kann, sondern dass er gezeigt und öffentlich vorgeführt werden muss, um überhaupt zum Leben zu erwachen. Dem Medium wohnt somit ein nie ganz aufzulösender Konflikt zwischen der Beschaffenheit des Materials und den Bedingungen der Vorführsituation inne oder, allgemeiner gesagt: Jeder Film ist geprägt von einer Spannung zwischen Innerlichkeit und Öffentlichkeit. Denn erst in der öffentlichen Vorführung werden aus einzelnen materiellen Spuren und Ablagerungen tatsächlich Bilder, wird dem an sich völlig ungeordneten sinnlichen Gehalt des Filmmaterials eine Struktur und somit die Grundlage von Sinnhaftigkeit und Lesbarkeit aufgeprägt. Das Material selbst jedoch kennt so eine Sinnhaftigkeit nicht – ja es leistet ihr sogar Widerstand, es drängt darauf, sämtliche allzu klaren Bedeutungen immer wieder durch seine unüberschaubare Fülle an Formen, Rhythmen und Sinneseindrücken ins Wanken zu bringen.
Zerrissen zwischen Innerlichkeit und Öffentlichkeit

Diese grundlegende Zerrissenheit des Kinos ist auch das bestimmende Moment von Péter Lichters (in Co-Regie mit Bori Máté entstandenem) Experimentalfilm The Rub. In langen Sequenzen tauchen zwar immer wieder Gestalten, klare Formen und eindeutige Bilder auf, und manche werden auch als Einstellungen aus bekannten Filmen erkennbar, doch all dies wird überlagert und zersetzt von einem Sturm an Farben, einem Gewirr aus weißen Flecken und wilden Kratzern, einer tumultartigen Auslöschung, die eher wie eine Befreiung erscheint. In seiner Wirkung erinnert The Rub hier teilweise an jene Filme Stan Brakhages, die nur durch Bemalung eines unbelichteten Filmstreifens erstellt wurden, oder an die found footage-Filme Bill Morrisons, die in ihrer Verarbeitung von altem, halb verfaultem Filmmaterial die Spuren einer fortschreitenden materiellen Auflösung zum zentralen visuellen Moment machen. Unterbrochen werden diese Sequenzen immer wieder von ausgewaschenen Videobildern, auf denen Eindrücke aus einem leeren Kino zu sehen sind: ein stiller Flur, vereinzelte Glühbirnen an einer Saalecke und vor allem das strenge Rechteck einer grauen Leinwand: eine Bühne, die mit ominöser Beharrlichkeit darauf drängt, bespielt zu werden.

Das Widerspiel zwischen der inneren Dynamik des Materials, die durch keine stabile Bedeutsamkeit gehemmt wird, und dem öffentlichen Raum, der in seiner Starrheit just so eine Bedeutsamkeit herauszufordern scheint, wird in The Rub beständig rückgebunden an Shakespeares Hamlet – und damit an eine, zumindest auf literarischer Ebene, paradigmatische Verarbeitung des Konflikts zwischen der privaten Sphäre des Erlebens und Reflektierens und der öffentlichen Sphäre des Kommunizierens und Handelns. Während die wilden Filmschnipsel und brodelnden Farbwolken auf der Leinwand vorbeihuschen, werden in leisem Ton (und auf Ungarisch) längere Passagen aus Shakespeares Stück vorgelesen – allesamt Monologe, in denen sich Hamlet seine eigene Abgesondertheit, seine Distanz zu der höfischen Gesellschaft und der menschlichen Gemeinschaft im Allgemeinen immer wieder vor Augen führt. Während der Videosequenzen hingegen hört man andere Figuren des Stückes, Hamlets Mutter oder seinen Onkel; ihre Sätze erklingen auf Englisch, vermittels historischer Aufnahmen und in einem hohen, getragenen Tonfall, der sich an würdevollen und auf Eindringlichkeit bedachten Aufführungstraditionen orientiert.
Ein stummes Mitglied des Hofstaats

Doch gerade die enge Verwobenheit mit Shakespeares Stück verdrängt im Laufe von The Rub den eigentlichen, auf filmischer Ebene stattfindenden Konflikt mehr und mehr. Die Textebene tritt in Lichters Film irgendwann nicht mehr in einen produktiven Dialog mit den wilden und ungeordneten visuellen Eindrücken, sondern hält sie nur mehr fest umklammert. So entspricht etwa die Abfolge der vorgelesenen Monologe in The Rub größtenteils der Abfolge innerhalb von Shakespeares Stück: Hamlet schimpft auf seine Mutter, sieht das Gespenst seines Vaters, plant die den Mörder entlarvende Theateraufführung, spricht mit dem Schädel des armen Yorick und verabschiedet sich schließlich sterbend von seinem Freund Horatio. Auf diese Art wird dem Film irgendwann der narrative Rahmen des Stückes nahezu komplett aufgezwängt – was auf der Leinwand zu sehen ist, erscheint dann nur mehr als eine Illustration dieser (in ihren Grundzügen zumindest) allbekannten Geschichte. Auch kommt es dann auf der Bildebene allzu oft zu einfachen Dopplungen des im Text Gesagten: Bei „two brothers“ sieht man zwei lachende Jungen, bei „my thoughts be bloody“ sieht man verwundete Soldaten, wenn vom Hofnarren Yorick die Rede ist, sieht man den Filmclown Jim Carrey, und auf „the rest is silence“ folgt ein leerer, weißer Filmkader. Text und Bild umkreisen sich in diesen Momenten der Synchronizität zwar in einer Art von Tanz, doch ist dies ein Tanz mit einer klaren Rollenverteilung: Der Text führt, das Bild folgt.

Die Stabilität des Shakespeare’schen Textes gerät nur dann ins Wanken, wenn plötzlich aus dem Rauschen und Knacksen im Hintergrund einzelne Worte und Sätze hervortreten, die in ihrem Duktus schnell als Bruchstücke aus Filmdialogen erkennbar sind. Erst der Klang dieser fremden Stimmen und ihr Hindeuten auf konkrete, aber nie ganz greifbare Gesprächssituationen – „I can’t sleep. Haven’t slept. Keep taking pills.“ – lassen einen eigenständigen Bedeutungsraum entstehen, der sich nicht einfach von dem Rhythmus der Shakespeare’schen Blankverse vereinnahmen und besetzen lässt. Es bedarf somit in The Rub dann letzten Endes doch wieder der Sprache, um das feste Korsett der literarischen Vorlage, in das sich der Film willentlich eingeschnürt hatte, wieder ein wenig zu lösen – die Ebene der ungeordneten sinnlichen Erfahrung erscheint demgegenüber als völlig machtlos angesichts der klaren logischen Strukturen des gesprochenen Wortes. Das filmische Material, dessen destabilisierendes Potenzial zu Anfang des Films noch so deutlich spürbar war, tritt im Laufe von The Rub mehr und mehr in den Hintergrund der Filmerfahrung – es wird zu einem namenlosen Mitglied des Hofstaats, das nur stumm dabei zusehen kann, wie andere am Bühnenrand das eigentliche Drama aufführen.
Neue Kritiken

Marty Supreme

Father Mother Sister Brother

The Day She Returns

Prénoms
Trailer zu „The Rub“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (7 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.