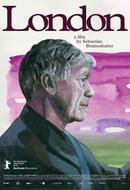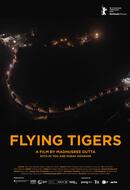The Cemetery Club – Kritik
Es ist mehr als ein Ritual. Jeden Samstag treffen sich aus Polen nach Israel emigrierte Überlebende des Holocaust auf dem Nationalfriedhof von Jerusalem, um sprichwörtlich über Gott und die Welt zu diskutieren.

Es ist ein skurriles Bild, das sich jeden Samstag Morgen auf dem Nationalfriedhof Mount Herzl in Jerusalem beobachten lässt. Eine Senioren-Karawane – das Grau und Weiß ihrer Haare sticht einem inmitten der grünen Vegetation sofort ins Auge – zieht ausgerüstet mit Klappstühlen und Essensboxen durch die Gräberlandschaft, um im Schatten einer Pinie ihren Versammlungsort aufzuschlagen. Die Männer und Frauen, die hier zusammengekommen sind, bilden eine soziale Gemeinschaft, eine Art Club – den Cemetery Club. Dabei geht die Bezeichnung auf die Regisseurin und Autorin Tali Shemesh zurück. Wie das einleitende Interview mit der resoluten Lena zeigt – Juristin von Beruf und eine der dominanten Persönlichkeiten der Gruppe – können sich die Senioren nicht wirklich mit der Umschreibung anfreunden. Friedhof, das weckt bei den meisten nur deprimierende und wenig ermutigende Assoziationen. Dabei sind ihre wöchentlichen Treffen das genaue Gegenteil: lebendig, diskussionsfreudig und gesellig. Offiziell nennen sie sich die „Mount Herzl Academy“.
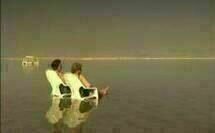
Allesamt haben sie den Holocaust überlebt, während viele Angehörige und Freunde den Verbrechen der Nazis zum Opfer fielen. Polen war ihre Heimat, ehe sie nach Israel kamen, Familien gründeten und es zu einem gewissen Wohlstand brachten. Tali Shemesh begleitete über einen Zeitraum von fünf Jahren die regelmäßigen Zusammentreffen des Cemetery Clubs. Die Mitglieder nutzen das gemeinsame Essen und den Diskurs einerseits als Möglichkeit, im hohen Alter geistig noch fit zu bleiben, andererseits beugen sie damit zugleich der Vereinsamung vor. Ein entsprechender Passus in den Statuten des Clubs spricht sogar das gesellschaftliche Tabu der Vereinsamung im Alter ganz direkt an, auch wenn sich nicht alle unbedingt damit identifizieren wollen und können. Natürlich mischen sich auch immer wieder Erinnerungen an das Grauen des Holocaust, an die persönlichen Verluste und den Horror jener Zeit in die Gespräche der Teilnehmer.
Die Impressionen aus dem „Club-Leben“ bilden jedoch nur einen von zwei Erzählsträngen des Films. Daneben schildert Shemesh die sehr persönliche Geschichte der gelernten Juristin Lena und deren zuweilen problematische Freundschaft zu ihrer Schwägerin Minya – Shemeshs Großmutter. Beide Frauen könnten in ihren Persönlichkeiten unterschiedlicher nicht sein. Während Minya sich meist in Zurückhaltung übt, ruhig und versöhnlich wirkt, eckt Lena mit ihrem fordernden und harschen Ton des Öfteren an. Sie hat auch kein Problem damit, anderen ins Wort zu fallen. Augenblicke wie die am Toten Meer, wo die Frauen gemeinsam Urlaub machen, besitzen einen charmanten Witz, der an die geriatrischen Granteleien zwischen Jack Lemmon und Walter Matthau in Ein verrücktes Paar (Grumpier Old Men, 1995) erinnert. Ohnehin finden sich zahlreiche hinreißend komische Momente in The Cemetery Club. Obwohl der Tod nicht nur aufgrund des Schauplatzes allgegenwärtig ist – im Laufe der Dreharbeiten starben drei der anfänglich zwanzig Mitglieder der „Mount Herzl Academy“ – hütet sich Shemeshs Dokumentation vor einer Überinszenierung von Melodramatik.

Ganz im Gegenteil. Ihre enge Verbundenheit mit Lena setzt die Filmemacherin behutsam ein, um in längeren Interviewsitzungen das zur Sprache zu bringen, worüber die alte Dame gemeinhin nur sehr ungern redet. Über die Erinnerungen an ihre einzige große Liebe, über die Zeit im Ghetto von Lodz und später dann in Bergen-Belsen und Auschwitz, über ihren Vater, der an Unterernährung starb und den frühen Tod ihrer Schwester. Die Kamera bleibt dabei immer ein sehr zurückgenommener und respektvoller Beobachter. Eher schüchtern nimmt Shemesh die Interviews aus gebührendem Abstand auf, teilweise verdecken andere Gegenstände oder der Türrahmen Teile des Bildausschnitts. Ein solch personalisierter und subjektiver Blickwinkel versetzt den Zuschauer in die Rolle eines intimen Mithörers, der die Gründe für Lenas oftmals fordernde und anstrengende Persönlichkeit zu verstehen beginnt.
Über die Wechsel zwischen den Treffen der Gruppe, ihre teils hitzigen Debatten, die immer wieder die enge Verzahnung der jüdischen mit der deutschen Kultur dokumentieren, und den Aufnahmen mit Minya und Lena gelingt The Cemetery Club ein warmherziges und zugleich unerwartet humorvolles Portrait einer Generation, der einst alles genommen wurde.
Neue Kritiken

Allegro Pastell

A Prayer for the Dying

Gelbe Briefe

"Wuthering Heights" - Sturmhöhe
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.