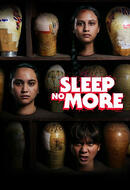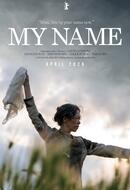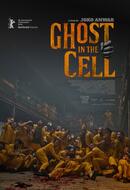Die Katzen vom Gokogu-Schrein – Kritik
Die Katzen in Ushimado sind ausnahmslos süß – aber viel zu viele. Kazuhiro Sodas Dokumentarfilm zeigt handfeste biopolitische Maßnahmen und vorbildliches community building – mit viel Witz, gutem Auge und Gespür für kleine und große Gesten.

Ein Film, dessen Titel Katzen verspricht, steht unter akutem cuteness-Verdacht. Kazuhiro Sodas verspielter Dokumentarfilm Cats of Gokogu Shrine – bereits seine vierte Einladung ins Forum der Berlinale – erfüllt das Versprechen und bestätigt den Verdacht. Etliche Katzen laufen oder liegen über die zweistündige Laufzeit auf der Leinwand herum, ihre Namen werden im Abspann genannt (sie lauten Sahne, Kuh, Michael etc.). Ehre, wem Ehre gebührt. Und ja, nebenbei sind sie tatsächlich ausnahmslos süß. Nur gibt es eben viele von ihnen, zu viele, meinen jedenfalls die Einwohner von Ushimado, zu denen auch der Regisseur selbst gehört. Denn die Katzen haben sich an einem heiligen Ort niedergelassen, dem Areal um den Shintō-Schrein Gokogu, gelegen in einer Urlaubsregion an der Küste, die ein Tourismus-Portal als „japanisches Mittelmeer“ anpreist. Eine hohe Steintreppe führt vom Fuß des Hügels zum Schrein hinauf, ein regelrechter stairway to cat heaven, wenn nicht gar mehr.
Catfishing mal anders
Für die einen sind die Katzen willkommene Gäste, die gestreichelt und gefüttert werden wollen; die anderen stören sich am Unrat, den sie hinterlassen. Einige setzen auf drastische Abschottung und ziehen Mauern aus Plastikflaschen und Nägeln hoch, damit ihre Gärten vom gefürchteten Katzenkot verschont bleiben. Es gibt aber auch kooperativere Methoden. Die Hobbyangler etwa, die kulant mit ihrem Fang umgehen und eine rote Katzenmutter gewähren lassen, wenn sie Fische stibitzt und anschließend zu ihren Jungen trägt – catfishing mal anders.
Oder eine Gruppe engagierter Freiwilliger, denen das Wohl der Katzen und das Wohl der Menschen gleichermaßen am Herzen liegen. Sie organisieren regelmäßige Tierarztbesuche, um die Katzen kastrieren zu lassen und die sich anbahnende Plage in den Griff zu bekommen. Handfeste biopolitische Maßnahmen, die nicht mehr allzu niedlich sind. Zugleich wird hier vorbildliches community building betrieben: Man kommt zusammen, hilft einander, und überhaupt hat man was zu tun. Die Katzen sind ja ohnehin vom Menschen abhängig; Natürlichkeit ist, nicht zuletzt im Kino, fast immer hergestellt – warum sollte man dieses Spannungsverhältnis nicht gemeinsam ausloten?
Fliege und Wand in einem

Kazuhiro Soda hat es versucht. Mit viel Witz, gutem Auge und einem Gespür für die kleinen und große Gesten. Obwohl die Texteinblendung zu Beginn einen „observational film“ ankündigt, hat das, was man später sieht, mit teilnahmsloser Beobachtung wenig zu tun. Das Bild der fly-on-the-wall wird in der Tradition des Direct Cinema verwendet, um eine zurückgenommene Art des Filmens zu beschreiben, bei der die Kamera ihre Präsenz so verschleiert, dass der Eindruck entsteht, sie registriere alles bloß beobachtend, wie eine unbemerkte Fliege. Für Sodas Film trifft das nicht zu. Seine Kamera nämlich ist Fliege und Wand in einem.
Einerseits Fliege, die suchend umherschwirrt, wenn sie den Katzen und den Anwohnern Ushimados hinterherwackelt. Andererseits fungiert Soda auch als – vierte, stimmlich präsente – Wand, die konstant gebrochen wird, sobald sich die Gesprächspartner direkt an die Kamera wenden. Im Fußballjargon ist seit einiger Zeit vom „Wandspieler“ die Rede, um einen robusten Stürmertypen zu beschreiben, der die Bälle seiner Mitspieler geschickt abprallen lässt, um seiner Mannschaft neue Räume zu eröffnen und das Spiel zu verlagern. Das erfordert nicht nur Finger- und Fußspitzengefühl, sondern auch die Bereitschaft, im richtigen Moment zurückzutreten, sich nicht so wichtig zu nehmen.
Der Regisseur verfügt über ähnliche Qualitäten; er vermag es, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Durch direktes Fragen, aber auch durch seine schlichte Anwesenheit entlockt er den Subjekten vor der Kamera Reaktionen, wobei die Menschen mitteilsamer auftreten als die Katzen. Eine Schulklasse fragt, was Sodas Lieblingsgericht sei. Ein alter Mann, der auf dem Gelände gemeinnützige Gartenarbeit leistet, will wissen, was es an diesem Ort Lohnenswertes zu filmen gebe. Und gleich mehrfach wird Soda auf den flauschigen Windschutz seines Mikrofons angesprochen bzw. richtiggehend attackiert.
Es bleiben die irdischen Probleme

Der Welt mit offenem Visier und laufender Kamera zu begegnen, empfänglich zu sein für äußere Einflüsse und sie im Zweifelsfall herauskitzeln – das ist charakteristisch für Sodas dokumentarischen Ansatz. Die Balance zwischen Intervention und Distanz zu halten ist nicht einfach, aber ein sehr geeigneter Weg, um den – zumindest in akademischen Diskursen – immer durchlässiger werdenden Grenzziehungen zwischen Mensch, Tier und Umwelt auch ein formales Konzept an die Seite zu stellen, das den eigenen, bilderzeugenden Standpunkt nicht leugnet.
Bereits mit Peace (2010) hat Soda einen Katzenfilm gedreht, der die Koexistenz der Lebewesen mit sehr existenziellen Fragen nach Leben, Tod und der Krankheit zum Tode überblendet. Behutsam zeichnet er dabei das Bild einer überalterten japanischen Gesellschaft, die am steigenden Pflegebedarf und der Vereinsamung vieler Menschen im Alter laboriert. Bei ökonomisch grundierten Unzulänglichkeiten des Systems bleiben vorerst nur das ehrenamtliche Engagement und die Überzeugung, weiterzumachen.
In Cats of Gokogu Shrine greift Soda diese Themen wieder auf und skaliert sie noch stärker ins Metaphysische. Es bleiben die irdischen Probleme: Die Katzen bekommen zu viel Nachwuchs, die Japaner zu wenig. Dazu Finanzierungsengpässe, Katzenkot und die Gemeinschaft, die dagegenhält, indem sie neue Pflanzen pflanzt und alte Gebete betet. Im Film vergehen Jahreszeiten, ein Taifun zieht vorüber, am Anfang und am Ende steht die Blütezeit; ein Kreis, der sich schließt, aber auch ein Neubeginn. Denn allen Versuchen, die Katzenpopulation zu regulieren, zum Trotz, gibt es einen natürlichen Lauf der Dinge, der – zumindest bis jetzt – immer die Oberhand behalten hat. Oder die Oberpfote.
Neue Kritiken

Ella McCay

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo

No Other Choice

Ungeduld des Herzens
Trailer zu „Die Katzen vom Gokogu-Schrein“

Trailer ansehen (1)
Bilder
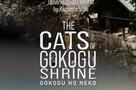



zur Galerie (4 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.