Synonymes – Kritik
VoD: In Nadav Lapids Synonymes versucht ein von seiner Militärvergangenheit zerrütteter Israeli, sich in Frankreich als Bohème neu zu erfinden. Stattdessen gerät die ganze Welt aus den Fugen.

Ein Körper, zum Bersten gefüllt von Erinnerungen. Ein Geist, vom Wunsch beseelt zu verdrängen. Traumatische Energie, die raus muss. Ein Mund, der plappert und plappert in einer fremden Sprache, einer Sprache, die frei ist von der Last des Erlebten. Bewegung, rastlose Bewegung. Der Körper, der Mund, die Bewegungen gehören dem Schauspieler Tom Mercier; die Erinnerungen, das Trauma, die Vergangenheit, gehören zur Figur, die er verkörpert: Joav, ein Israeli, gestrandet in Paris, geflohen vor den Erlebnissen im Militär eines Landes, das für ihn dem Untergang geweiht ist.
Die infizierte Kamera

Nadav Lapids Synonymes ist ein Film der Entäußerung, ein Film über ein Inneres, das sich umstülpt und hinausschwappt ins Außen. Ein Film über eine Psyche, die den Raum besetzt wie ein zu eroberndes Territorium, den dreidimensionalen Raum, in dem man rennen, stürzen, sich an anderen abstoßen und ihnen in die Arme fallen kann – und den akustischen Raum, in dem Worte manchmal verhallen und manchmal gehört werden, von denen um uns.
Da ist Émile (Quentin Dolmaire), der scheiternde Schriftsteller mit dem reichen Papa, der sich an Yoavs wirren Geschichten über Israel ansteckt und in sein barockes, ganz und gar eigenes Französisch verliebt. Und da ist Carolin (Louise Chevitolle), die zugleich abgestoßen und angezogen ist von der zügellosen männlichen Energie, die Yoav ausstrahlt und die sich in seinen sehnigen Kraftkörper und den stets halberigierten Penis verknallt. Zwei sich in großbürgerlichen Verhältnissen vor sich hin langweilende Zentraleuropäer und ein Wirbelwind der Traumata aus Nahost.
Die Kamera wird ständig infiziert von Yoavs brodelnder Rastlosigkeit, springt immer wieder in seine wild umherschießende Blickwelt, nur um dann wieder Abstand zu suchen und seine hilflosen Pirouetten verwundert zu betrachten. Klaustrophobie wechselt sich ab mit urkomischem Körperhumor: Eben noch wird einem schlecht, orientierungslos vor lauter wild zuckenden Wegpflaster und vorüberflirrender Häuserfassaden. Aber dann entlädt sich die Spannung in Lachen, wenn ein bibbernder Yoav im Schlafsack durch die unbeheizte Wohnung hüpft. Er springt ins Bad, zum tröpfelnden warmen Wasser. Doch als er heraus kommt, sind seine Sachen weg und ein splitternackter blaulippiger Berserker tobt durch ein herrschaftliches Treppenhaus. Yoav kommt als Tier in die Kulturmetropole Paris. Halb erfroren finden ihn Émile und Carolin, decken ihn mit Fell zu und kleiden ihn dann in ein senfgelbes Hipsteroutfit. Diese Verkleidung wird Yoav nie wieder ablegen.
Israel vergessen

Sein Bruch mit der Heimat soll total sein. Er hat sich ein hartes Regiment der Entsagung verordnet: Jeden Tag isst er dasselbe (Nudeln mit Tomatensoße, 1,28 € die Portion), läuft durch die Straßen, blickt nie hinauf auf die Reize der Stadt, um ja nicht zum Touristen zu werden und damit draußen zu bleiben aus dem Leben. Er weigert sich beharrlich, Hebräisch zu sprechen, liest stattdessen in einem Wörterbuch, aus dem er kaskadenartig Begriffsakkorde strömen lässt: „Widerlich, idiotisch, obszön, böse...“ Die Synonyme werden alsbald in Sätze gepfeffert: „Israel, dieses wiederliche, idiotische, obszöne Land...“
Es ist gut, dass dieser seine Herkunft so hemmungslos verteufelnde, sein Heimatland hassliebende Film vom israelischen Staat gefördert wurde. Genau dafür ist Filmförderung doch da, um Wagnisse, Risiken und Angriffe aufs kulturelle Selbstverständnis zu ermöglichen, um dahin zu gehen, wo es wehtut. Es ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass die israelische Armee alljährlich viele traumatisierte Menschen in die weite Welt entlässt, die nach drei Jahren Militärdienst im Rausch aus Drogen, Parties und Travelling häufig nur eines wollen: Vergessen. Vergessen, wo sie herkommen und was sie im Namen ihres Landes haben tun müssen.
Nadav Lapid übt denn auch beißende Kritik an der Idee des Nationalismus, sei es der israelische oder der französische. Im Integrationskurs schmettert Yoav inbrünstig den Text der Marseillaise: „Unreines Blut, tränke unsere Furchen!“ Komisch ist die Szene im Moment, gruselig im Nachhall. Finden nicht alle Völker ihre Einheit im Hass auf die anderen? Nationalismus ist ein Witz, aber ein bitterer.
Ein Rausch mit garantiertem Kater

Aber Yoav kann Israel und den Israelis nicht entfliehen. Das heißt vor allem: den israelischen Männern. Eine Reihe oberviriler, grundaggressiver Typen begegnen ihm, die jedoch statt seiner radikalen Abkehr zur Hyperidentifikation mit ihrer Nation und ihrem Jüdischsein neigen, die nur von Kampf, Terrorismus und Moslems reden. Einer rückt, die Kippa auf dem Kopf, U-Bahn-Fahrgästen bedrohlich nahe auf den Leib. Ein anderer organisiert Prügelorgien mit französischen Neonazis und trällert „Mohammed ist tot“ beim Motorradfahren. Es ist schon eine besonders gewagte politische Entscheidung, dass hier alle Aggressivität und Gewalt von Juden ausgeht, zumal der Film in einem Land spielt, das aktuell stark mit Antisemitismus und der Erosion seiner jüdischen Gemeinde zu kämpfen hat. Aber Synonymes geht viele Wagnisse ein, er will ganz offen verstören und aus der Ruhe bringen. Eine Szene, bei der sich der mittellose Yoav für einen perversen Fotografen den Finger in den Arsch steckt, kann schwerlich den Eindruck einer gewissen Homophobie vermeiden. Aber in der Erniedrigung wohnt hier auch ein kathartisches Moment für Yoav.
Und so machen alle Abgründe im Moment des puren Erlebens Sinn. Synonymes ist wie ein Rausch mit garantiertem Kater, wie ein Popsong, der hoffnungslose Texte in fröhliche Rhythmen hüllt: eingängig, mitreißend, melodisch, aber im Herzen rettungslos verzweifelt. Am Ende des Filmes ist alles kontaminiert, mit jedem wilden Überschwang wird das Gefühl einer schrecklichen, drohenden Explosion stärker. Einmal gibt es einen Flashback, der den Soldaten Yoav bei Schießübungen zeigt. Er hält das Handy ans Ohr. Ein französischer Chanson erklingt und Yoav drückt den Abzug im Rhythmus des Lieds. Die Sprache der Liebe, der Sound des Maschinengewehrs, sie überlagern sich, bis nur noch der Wahnsinn tönt. Alle Kugeln treffen derweil ins Schwarze.
Der Film steht bis zum 22.02.2022 in der Arte-Mediathek.
Neue Kritiken

Primate

Send Help

Little Trouble Girls

White Snail
Trailer zu „Synonymes“




Trailer ansehen (4)
Bilder


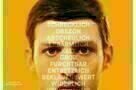

zur Galerie (11 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Filmhaus Nbg
Liebes Team,
sehr gerne lesen und teilen wir eure Kritiken und hängen sie auch in unserem Kino Foyer ausgedruckt aus, leider stört in der Druckansicht der Button "Unterstützen" etwas, der natürlich ansonsten sehr wichtig ist...
vielen Dank, herzlich
Filmhaus Nürnberg
Markus
Hammerkritik, Danke dafür!
Frédéric
Liebes Team vom Filmhaus Nürnberg,
das Problem mit der Druckansicht sollte nun behoben sein!
Schöne Grüße
Frédéric

















3 Kommentare