Südostpassage. Eine Reise zu den neuen weißen Flecken auf der Landkarte Europas – Kritik
Ulrike Ottingers sechsstündiger Dokumentarfilm ist zugleich eine Reise von Deutschland über Osteuropa nach Odessa in der Ukraine, die schließlich in dem eurasischen Istanbul ihr Ziel findet. Mit Hilfe literarischer Texte bieten die Bilder des sich als Momentaufnahme verstehenden Filmes einen nicht immer gelungenen, aber sehr faszinierenden Blick auf die „weißen Flecken der Landkarte Europas“.

Auf der Documenta11 stellte Ulrike Ottinger 2002 ihren Film Südostpassage erstmals vor, der mit einiger Verspätung nun auch in die Kinos gelangt. Dabei wurde das sechsstündige Werk dreigeteilt, was durchaus der inneren Struktur des Films entspricht. Denn während der erste Teil mit seinem Titel Wrocław – Varna bereits eine Entfernung (von immerhin fast 1200 km!) symbolisiert und damit zugleich eine Reise erahnen lässt, wirken die Titel der beiden folgenden Teile fast statisch: Odessa, mit 142 Minuten der längste der drei Teile, und Istanbul, mit 93 Minuten der kürzeste, präsentieren das Leben in diesen zugleich gegensätzlichen und verwandten Städten.
Damit vermittelt der Film durchaus eine gewisse Uneinheitlichkeit, die sich insgesamt leider auch zu Ungunsten der beiden letzten Teile auswirkt. Jede der 128 Minuten von Wrocław – Varna ist spannend, belehrend, aufschlussreich und irritierend – und bietet damit alles, was in den folgenden Stunden oft wie eine Wiederholung wirkt. Hinzu tritt, dass die Unterbrechungen der Stadt- und Dorfansichten mit Straßenbildern eine Form der (wieweit auch immer verlangsamten) Dynamik zu repräsentieren vermögen, die sich in dem Wechsel der Länder und Orte, und damit den Veränderungen in der Kultur, variierend wiederholt; in den Städteportraits Odessa und Istanbul muss dies freilich fehlen – und kann durch die Sehenswürdigkeiten der beiden Städte, etwa die Potemkin-Treppe in Odessa oder die Hagia Sophia in Istanbul, schon deshalb nicht aufgehoben werden, weil diese eben doch zu bekannt sind.
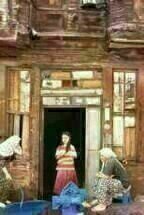
Was zeigen nun aber die Bilder des Filmes? Sie zeigen einen Teil Europas, den politische und soziale Umwälzungen in den letzten zwei Jahrzehnten radikal verändert haben und in denen sich dennoch Elemente einer Kultur ganz lebendig erhalten haben, die vor allem vergangene Jahrhunderte geprägt haben; letzteres wird auch am Beispiel Istanbuls deutlich. Ulrike Ottinger interessiert aber vor allem, was sich von der Kultur des beginnenden 20. Jahrhunderts im ehemaligen „Ostblock“ erhalten hat. Dafür lässt sie literarische Kronzeugen sprechen, die allesamt um die Jahrhundertwende geboren wurden – neben anderen vor allem Elias Canetti, Sándor Márai, Joseph Roth, Ossip Mandelstam und Alexander Grin. Eine unglaublich suggestive Kraft hat es beispielsweise, wenn Hanns Zischler einen autobiographisch gefärbten Text Sándor Márais vorträgt, in dem dieser sein Geburtshaus, ein altes Jugendstilgebäude, beschreibt und lange Kamerafahrten an einem reich verzierten Treppengeländer oder an Bleiglasfenstern mit den typischen Blumenmotiven eben dieses Gebäude präsentieren. Während der Text hier in der Vergangenheit spricht, zeigen die Bilder die Gegenwart und beide berühren sich, fließen fast ineinander. Bei der Schilderung des Ostjudentums – vor allem in Odessa – kehrt sich dies um: Neben den ausführlichen literarischen Beschreibungen der Vergangenheit fungieren die verbliebenen Reste dieses Lebens in der Gegenwart, wie sie in Ruinen und meist zweckentfremdeten Synagogen gezeigt werden, vor allem als das Fehlen dieser Kultur, als deren Leerstelle.
Die Aufnahmen in dem Geburtsort von Sándor Márai – der heute in der Slowakei liegenden Stadt Košice (damals Kaschau) – entwickeln aber noch einen anderen, in den Bildern selbst liegenden Zwiespalt: Eine alte Bäuerin, ihrer Kleidung, ihrem ganzen Habitus nach fast eine Frau des 19. Jahrhunderts, steht im Heute, vor einem Kiosk mit den bekannten, bunten Unterhaltungszeitungen – es ist ein Bild, in dem nichts zusammenpasst und das doch sehr genau das versinnbildlicht, was die Regisseurin als ein Anliegen ihres Filmes formulierte: Die Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit der Lebensverhältnisse zu zeigen.

Dieser Gedanke trägt Ulrike Ottingers Film. Die ausgedehnten Szenen des Markttreibens etwa, zeigen eine Welt des Handels, wie er in der westlichen Welt schlicht unvorstellbar geworden ist. Märkte spielen ohnehin die Hauptrolle in diesem Film; womit zugleich auf die mehrfache Bedeutung des Wortes „Passage“ angespielt ist: Die (Südost-)Passage als Reise, als Form der Dynamik und die überdachte Einkaufspassage als Gebäude, als Form der Statik. Schon Walter Benjamin, der hier auch erwähnt wird, interessierte sich für diese „geile Straße des Handels“, wie er in seinem fragmentarischen Passagen-Werk formulierte.
Selbst wenn viele Bilder des – vielleicht doch zu langen? – Filmes nicht bloß touristisch, sondern vor allem in den Stadtporträts Odessa und Istanbul zum Teil auch beliebig wirken und auch wenn die Struktur besonders von Istanbul, welche sich an einer alten Legende orientiert, nicht überzeugt; ja selbst noch in Erinnerung an die eingeschobenen, schwarz-weiß gefilmten Spielszenen, die insbesondere mit der etwa 20-minütigen expressionistisch-theatralischen Inszenierung der Groteske Das Exemplar nach Valentin Katajew den Fluss des Filmes empfindlich stören – trotz all diesen Punkten bleibt Südostpassage ein lehrreicher, tiefgründiger und unterhaltender Film.
Neue Kritiken

Winter in Sokcho

Die Spalte

Hamnet

Die Stimme von Hind Rajab
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.









