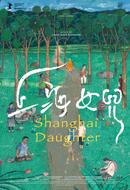Erhebe dich, du Schöne – Kritik
VoD: Erhebe dich, du Schöne porträtiert die äthiopische Sängerin Nardos Wude Tesfaw und ihre Musik als Kritik einer Gesellschaft under construction. Heidi Specognas Film macht verschiedene Angebote zum Lesen, Schauen, Hören und Riechen.

Es wird gebaut in Addis Abeba. Wo vorher noch Bäume standen, ist jetzt eine kahle Fläche, bereit, von der Zukunft bespielt zu werden. Die Aushänge in den Schaukästen verkünden freie Stellen, auf der Straße blättern die Menschen durch die Anzeigen in den Zeitungen. Doch der Aufbruch kündigt sich schon seit einer Weile an in der Hauptstadt Äthiopiens, wie sie Heidi Specogna in Erhebe dich, du Schöne präsentiert. Kein plötzliches Phänomen ist er, sondern ein Zustand, ein Versprechen, in dem sich dieser Ort eingerichtet hat, so sehr er möglicherweise nach außen vorgeben mag, sich neu zu erfinden.
Treffpunkt Musikclub

Nardos Wude Tesfaw weiß noch, wo sich früher die Bäume befanden und wie rissig die Hände werden können von Beton und Zement. Die Sängerin kommt eigentlich aus einem Dorf hinter dem nahe gelegenen Berg Entoto. Um der Kinderehe zu entgehen, wurde sie von der Mutter zur Tante nach Addis Abeba geschickt, später schlägt sie sich als Bauarbeiterin allein durch. „Niemand hat mich auf das Leben in der Stadt vorbereitet“, erinnert sich Nardos, die nun zwei Kinder zur Welt gebracht hat, verheiratet ist und erfolgreich Musik macht. Obwohl sie in ihrer Heimat ein Star ist, ist das Geld knapp. Fast jeden Tag tritt sie im Musikclub Fendika auf; nach Selbstaussage auch manchmal nur für einen Gast.
Das musikalische Programm entsteht im Fendika aus dem Stegreif. Gespielt wird das, was zur Stimmung des Publikums passt, die Nardos jeden Abend zusammen mit den anderen Instrumentalist*innen empathisch ermitteln muss. Im Musikclub haben sie und Regisseurin Specogna sich kennengelernt. Aus der Recherche für einen Film über äthiopische Jazzmusik wird nach der Begegnung ein Projekt über Nardos und ihre Musik, über Musik als Arbeit und ihre Möglichkeit zur Kritik an einer Gesellschaft, in der einiges under construction scheint. Fünf Jahre dauerten die Dreharbeiten für Erhebe dich, du Schöne, der sich der Entwicklung der Gegend widmet, durch die sich Nardos bewegt und als Ortskundige führt.
Das Eigenleben der Wörter

Die Sängerin, ihre Anekdoten und ihre Lieder bestimmen den Rhythmus des Films, geben einen Takt vor, den Specogna und die Kamera aufnehmen. Dabei führen die Songtexte in Erhebe dich, du Schöne ein auffälliges Eigenleben, fordern sie zuweilen die deutsche Übersetzung so dermaßen heraus, dass manche Auftritte ohne Untertitelung auskommen müssen. Das liegt auch in der Kunst der Azmari begründet, in deren Tradition Nardos steht und die sich durch das poetische Spiel mit Metaphern und Vieldeutigkeiten auszeichnet. Bedeutung sei nicht einfach gegeben in einer Liedzeile, erklärt die Sängerin einmal, das Publikum verleihe eben immer der Bedeutung Aufmerksamkeit, die es hören will.
Auch Specognas Film strebt gegen Eindeutigkeit und Auflösung, macht stattdessen verschiedene Angebote zum Lesen, Schauen, Hören, Riechen, wenn Menschen schwitzen, Tauben fliegen, Kleider wie Erinnerungen zerfallen; wenn die Träume von Schwestern, Müttern und Töchtern zu Bleistiftstrichen in einem kleinen Heft werden, in dem Nardos ihre Geschichten sammelt, um sie musikalisch zu verarbeiten und für ein größeres Publikum hörbar zu machen; ein Heft, das unweigerlich an ein anderes Exemplar erinnert, in dem über 300 Frauen und Mädchen ihre Zeuginnenaussagen niedergeschrieben haben, um die Straftaten zu dokumentieren, die ihnen im Zuge von Kriegsverbrechen durch kongolesische Söldner angetan wurden (Cahier Africain, 2016).
Wandel mit Seifenblasen

Im Vergleich zu dieser vorherigen Arbeit von Heidi Specogna wirkt Erhebe dich, du Schöne hoffnungsvoller, optimistischer, obgleich auch dieser Film von Leid und seinen Spuren berichtet. Dieselben Orte werden mit zeitlichem Abstand gefilmt, die Aufnahmen überblendet, sodass ihre optischen Veränderungen in Erscheinung treten. Hier tut sich was, so will es uns das Stadtbild selbst erzählen. Aber durch die Erzählungen der Frauen ist es fraglich, für wen sich Wandel vollzieht, wer von welchen Umbrüchen profitiert, die nicht nur die Trennungen zwischen Stadt und Land, sondern auch unter den Bewohner*innen von Addis Abeba weiter vorantreiben. Am Ende steht bei Specogna ein Musikvideo mit Seifenblasen, mit Kindern und einer Künstlerin, die von der nahen Zukunft singt. Für einen kurzen Augenblick ist es schön, ihr voll und ganz zu glauben, bis wieder das Saallicht angeht.
Der Film steht bis 23.08.2023 in der 3Sat-Mediathek.
Neue Kritiken

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo

No Other Choice

Ungeduld des Herzens

Melania
Trailer zu „Erhebe dich, du Schöne“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (6 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.