Spuren von Bewegung vor dem Eis – Kritik
Sich selbst veräußern: René Frölke taucht in Spuren von Bewegung vor dem Eis ein in das Archiv des Schweizer Pendo Verlags. Nicht die Rekonstruktion der Vergangenheit steht dabei im Vordergrund, sondern die Erfahrung der umfassenden Auflösung.

René Frölkes Spuren von Bewegung vor dem Eis beschäftigt sich mit zwei Nachlässen. Zum einen interessiert ihn Fritz Weigner, Ehemann von Gladys Weigner, die 1971 mit Bernhard Moosburger in Zürich den Pendo Verlag gründete, zum anderen interessiert ihn der Verlag selbst. Eine Montage führt durch ein paar ausgewählte Titel, die das Verlagsprofil gut umreißen. Auf Meine Trauer trag ich zum Gürteltier folgt Ist Partnerschaft überhaupt möglich folgt Revolution ohne Todesstrafe. Frölke nähert sich mit Super-8-Aufnahmen, umfangreichem Tonmaterial und eigens angefertigten Transkripten sowohl dem Verlagsarchiv als auch dem Menschen Fritz Weigner. Eintritt in beide Welten verschafft dabei vor allem Tessa Weigner, Tochter von Gladys und Fritz.
Formal ist Spuren von Bewegung vor dem Eis in seiner fragmentierten Form sowohl herausfordernd als auch intuitiv ansprechend. Dabei sticht besonders die von Frölke bereits in früheren Filmen angewandte Technik heraus, das Gefilmte und Gesagte zu transkribieren und diese Transkripte dann gegen das Bild zu schneiden. Als würde man den Film dazu mobilisieren, sich an sich selbst zu erinnern. Der Ton arbeitet auf eine ähnliche Weise. Mal ist er präsent, mal bricht er weg, dann übernimmt er wieder ohne jedes Bild den gesamten Film. Manchmal ist auch seine Quelle unklar. Eine frühe Passage zeigt Finger, die in der Luft zu einer Klaviermelodie spielen, während eine Stimme die Tastenfolge nachspricht. White. Black. Black. White. White. White. Ausgangspunkt und Ende der Reihe sind gleichermaßen offen. Die Montage gleicht sich in ihrem Schnitt dem Rhythmus der Klänge an, der Film ist zur Musik geschnitten ohne selbst Musik zu werden.
Das Bild muss in die Welt getragen werden
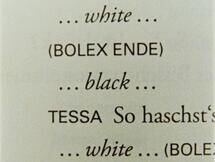
Jedes Archiv zeigt sowohl nach außen als auch nach innen. Praktisch gesprochen: Eine Signatur kennzeichnet sowohl eine Mappe in einem Karton als auch einen Eintrag in einer Datenbank. Um diese aber zu verifizieren, müssen beide Seiten miteinander abgeglichen werden, was in Filmsprache zurückübersetzt bedeutet: das Bild muss in die Welt getragen werden. Weniger, um mit den Bildern einen bestimmten Effekt zu erzwingen, als um die Bilder einer Welt zu übergeben. Man veräußert sich. Wie Derrida in Dem Archiv verschrieben summiert: „Kein Archiv ohne einen Ort der Konsignation, ohne eine Technik der Wiederholung und ohne eine gewisse Äußerlichkeit: Kein Archiv ohne Draußen.“
Dieses Draußen ist im ersten Teil des Films sowohl banal als auch familiär. Straßenaufnahmen und Freibadszenen reihen sich an die Suche nach einer Kirche, für die Fritz einst Glasmalereien anfertigte. Die Aufnahmen im Haus der Weigners kämpfen dann wiederum um Licht, schummern im Halbdunkeln. Das Haus ist vollgestellt mit Büchern und Krimskrams, es verwahrlost an der Masse der angesammelten Erinnerungen. Im weiteren Verlauf schrumpft das Außen dann immer mehr zusammen und der Film zieht sich wie eine Schnecke in das Haus zurück. Die Türen in deinem Zimmer führen dich zu den Türen in deinem Zimmer führen dich zu den Türen in deinem Zimmer und zu einem Fenster. Tessa wundert sich, wer es geöffnet hat. Es wird keine Antwort gefunden.
Als selbst das Haus zu groß wird, geht es runter in den Keller und rauf auf den Dachboden, wo jeweils Teile des Nachlasses schlummern. Es gibt kein Findbuch, keine Tektonik, kein Ordnungssystem. Nur Kartons. Sobald diese geöffnet werden und sich ihr Inhalt auf den Boden ergießt, gleicht sich der Keller dem Rest des Hauses an. Man sucht eine bestimmte Box, aber man findet sie nicht. Der Film wird ebenfalls kleinteiliger, arbeitet sich an Transkriptionen von Seminaren und Predigten ab, die Fritz Weigner zeit seines Lebens angefertigt hat. Obwohl sich der Film mehr und mehr der theologischen Praxis von Weigner widmet, schafft es Frölke nie, dessen inhaltliche Positionen klar herauszukristallisieren. Fritz bleibt, wie so vieles, im Halbschatten, nur als Silhouette greifbar.
Das Archiv bewirkt die eigene Auflösung

Dies führt zu einem weiteren wichtigen Punkt des Films: seine Bewegung durch das Archiv führt zwangsläufig nicht zu Verständlichkeit, sondern zu deren Auflösung. Alles im Film Gezeigte lässt sich im Geschriebenen (Primärquellen oder deren Zweitkopie) spiegeln, aber nicht lösen. So führt laut Derrida die Konsignation auch zu einem Wiederholungszwang, der nach Freud gelesen untrennbar vom Todestrieb ist. „Konsequenz: selbst in dem, was die Archivierung ermöglicht und bedingt, werden wir niemals etwas anderes finden als das, was der Destruktion aussetzt und wahrlich mit der Destruktion bedroht … Das Archiv arbeitet allzeit und a priori gegen sich selbst.“ Genau wie – um eine Parallele aufzumachen, die der Film selbst nicht zieht – auch der analoge Film durch sein konstantes Abspielen sich selbst gleichzeitig auslöscht, bis die Kopie erblindet.
Eine Einsicht, die theoretisch bedeutsam sein mag, die aber praktisch den Film spurlos verhallen lässt. Nach einer Stunde ist eigentlich schon alles gesagt und man wartet, bis der Nebel sich lichtet – was er natürlich nicht tun kann. Nur die privaten Filmaufnahmen behalten ihre Wirkung. Tessa und Bernard. Wie sie kommunizieren. Mit sich. Mit der Kamera. Die Tiere. Ein Hund. Ein paar Fische. Ein Frosch. Und Frölke und sein Transkript: Eine Obsession, die sich auch in sich selbst auflösen wird, bis sie wieder neu geschrieben wird, geschrieben werden muss.
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Trailer zu „Spuren von Bewegung vor dem Eis“

Trailer ansehen (1)
Bilder


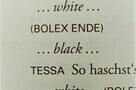
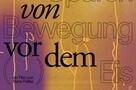
zur Galerie (4 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.







