SPK Komplex – Kritik
Die Krankheit als Waffe, oder wie ein Anti-Psychiatrie-Projekt zwischen den Erzählungen von „staatlicher Repression“ und „gewaltsamem Widerstand“ zerrieben wurde. Im Nebel dieser Erzählungen findet SPK Komplex die einzige lebendige Spur der Vergangenheit.

Im Zentrum von SPK Komplex steht ein Phantom. Detailliert erzählen Zeitzeugen und Zeitzeuginnen in Gerd Kroskes Film davon, wie der Psychiatriearzt Wolfgang Huber in den frühen 70er Jahren die Psychiatrische Poliklinik in Heidelberg verließ, um das Sozialistische Patientenkollektiv zu gründen. In dieser gemeinschaftlich organisierten, hierarchielosen Einrichtung ging Huber davon aus, dass psychisches Leiden vor allem als politisches Phänomen zu verstehen sei, als Folge eines von Zwang und Unterdrückung bestimmten Systems. Folglich könne man dieses Leiden nicht mit herkömmlichen psychiatrischen Methoden heilen, sondern vor allem durch politische Interventionen und „Bewusstmachung“.
In den Erzählungen der damals Beteiligten wird deutlich, wie bestimmend die Persönlichkeit Wolfgang Hubers für die Entstehung und den Charakter des SPK war. Doch Huber selbst tritt in Kroskes Film kaum in Erscheinung: Ein paar Fotos, einige Tonaufzeichnungen und eine einzige, kurze Filmaufnahme – mehr hat diese charismatische Figur an greifbaren Spuren anscheinend nicht hinterlassen. Wolfgang Huber, das ist in SPK Komplex somit weniger ein konkretes, handelndes Individuum als vielmehr ein Sinnbild für eine Vergangenheit, die sich jedem unmittelbaren Zugriff entzogen hat und deren einstmalige Lebendigkeit und Offenheit heute nur mehr als undeutliches Echo vernehmbar ist.

Dazu passt, dass der genaue Charakter von Hubers Gegenentwurf zur damals herrschenden Psychiatrie im Verlauf des Films eigentümlich vage bleibt. SPK Komplex liefert hierzu zwar immer wieder Bruchstücke, kurze Bemerkungen und Anekdoten, doch lässt sich aus ihnen nur ein notdürftiges, instabiles Bild zusammenschustern. Ein Interviewpartner erzählt von Sitzungen, in denen zu therapeutischen Zwecken Hegel gelesen und diskutiert wurde, und immer wieder ist die Rede davon, dass gerade das, was von dem herrschenden gesellschaftlichen System zur „Krankheit“ deklariert werde, dazu geeignet sei, ebendieses System auszuhebeln („Die Krankheit zur Waffe machen“). Doch inwiefern sich Menschen mit tatsächlichem psychischem Leidensdruck Hubers Patientenkollektiv zugewendet haben und inwieweit seine Methoden hier imstande waren zu helfen – das lässt der Film weitgehend unbestimmt. Von der Idee des Patientenkollektivs bleibt in SPK Komplex somit nur die grundlegende Geste spürbar: der bloße Impuls zur Ent-Hierarchisierung einer erstarrten und verkrusteten Institution.
Der Standardtanz der Radikalisierung

Doch die Unbestimmtheit von Hubers antipsychiatrischem Projekt ist kein Versäumnis, sondern in gewissem Sinn das eigentliche Thema von Kroskes Film. Denn irgendwann mündet der Drang zur gesellschaftlichen Veränderung, dem das SPK entsprang, in jene Formen des Widerstands, die in ihrer Abfolge beinahe schon ein standardisiertes Erzählmuster bilden: Es kommt zu geheimen Treffen im kleinen Kreis, es werden Waffen angeschafft, irgendwann fällt ein Schuss auf einen Polizisten, es folgen Razzien, Festnahmen, tumultartige Gerichtsverhandlungen, Einzelhaft und Hungerstreik.
SPK Komplex ist somit die Geschichte einer Radikalisierung, wie man sie auch aus anderen Erzählungen der Jahre um und nach 1968 kennt – und in der Schilderung dieser Radikalisierung verliert das Ursprungsphänomen, von dem sie ihren Ausgang nahm, immer mehr an Bedeutung, bis die Gewaltfrage schließlich alles andere verdrängt: die Kritik an der herrschenden Psychiatrie, die Utopie einer Aufhebung des Unterschieds zwischen Behandelnden und Behandelten, die Aushebelung des Prinzips der „Behandlung“ selbst. Alle spezifischen Veränderungswünsche und Gesellschaftsentwürfe werden zu einer einzigen, einförmigen und im Grunde mechanischen Frage eingestampft: Wann muss geschossen werden? Denn wenn man geschossen hat, kann man verurteilt oder geächtet werden – aber es wird einem niemand vorwerfen, man hätte nichts getan. Diese dunkle Faszination der Gewalt – als die klarste und unzweideutigste Form der „Tat“ – ist auch in den Wortmeldungen mancher ehemaliger Mitglieder des SPK immer noch spürbar: Die Gewalt selbst wird zwar aufrichtig abgelehnt, aber auf die eigene Gewaltbereitschaft, auf die ist man immer noch ein bisschen stolz.
Ein Nebel konkurrierender Erzählungen
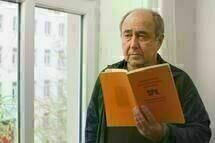
Die Fragen nach der personellen Verzahnung des innersten Kreises des SPK mit der RAF, nach den Umständen des Schusses auf den Polizisten, nach der Angemessenheit der staatlichen Gegenmaßnahmen – sie führen Kroskes Film immer tiefer hinein in einen Nebel der konkurrierenden Erzählungen. Gab es den sogenannten „inneren Kreis des SPK“ wirklich als eine gewaltsame Absonderung des allgemeinen antipsychiatrischen Projekts, oder war er nur eine Fiktion der staatlichen Behörden, um mehrere SPK-Mitglieder wegen „Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung“ anklagen und schließlich auch verurteilen zu können? Haben sich die Mitglieder einer kleinen Gruppe mit ihrer ideologischen Verbissenheit gegenseitig immer weiter bis hin zur Gewalttätigkeit radikalisiert, oder war diese Radikalisierung eine gleichsam unausweichliche Reaktion auf eine staatliche Repression, die jeden grundlegenden Reformansatz gleich zu einem staatsgefährdenden Umsturzplan erklärte?
SPK Komplex lässt diese gegensätzlichen Deutungsmuster weitgehend unberührt nebeneinander stehen. Es ist Kroskes Film ganz bewusst kein Anliegen, einzelne Beweisstücke anzusammeln, um diese oder jene Interpretation zu untermauern. Das mag stellenweise etwas frustrierend sein, vor allem, wenn man zwischen den einzelnen Gesprächspartnern und -partnerinnen ein wenig den Überblick verliert – doch gerade in dieser Frustration äußert sich schließlich eine ganz bestimmte Auffassung von „Geschichte“. Was von den bewegten 70er Jahren bleibt, was auch heute noch wirksam ist, das sind in SPK Komplex eben nicht die tatsächlichen historischen Ereignisse, sondern die Erzählungen, die sich um diese Ereignisse herum gebildet haben. Die Beteiligten von damals kommen aus ihren Rechtfertigungsnarrativen nicht heraus, zu eng ist die eigene Persönlichkeit und Biografie mit ihnen verbunden. Das Jahrzehnt des Widerstands nach 1968 tritt in SPK Komplex in erster Linie als ein persönliches Trauma in Erscheinung – das heißt aber auch, dass einen der Film mit der Frage, inwiefern die damalige Zeit ein produktiver Resonanzboden für die Debatten der Gegenwart sein kann, weitgehend alleine lässt.
Neue Kritiken

Marty Supreme

Father Mother Sister Brother

The Day She Returns

Prénoms
Trailer zu „SPK Komplex“

Trailer ansehen (1)
Bilder
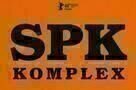
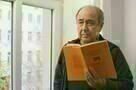

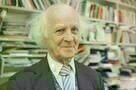
zur Galerie (11 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.








