Soundtrack für einen Staatsstreich – Kritik
Mit schwungvollem Agitprop-Gestus verbindet Soundtrack für einen Staatsstreich den Unabhängigkeitskampf des Kongos mit dem Jazz der 60er und den globalen Wirren des Kalten Krieges. Johan Grimonprez’ Dokumentarfilm ist dabei nicht immer souverän, aber auf charmante Art undidaktisch.

Soundtrack für einen Staatsstreich ist ein Film, der schwer zu beschreiben, aber gleichzeitig sehr eingängig ist. Das Rückgrat bildet der Unabhängigkeitskampf des Kongos in den 60er-Jahren, als sich die ehemalige Kolonie unter der Führung von Patrice Lumumba von der belgischen Herrschaft befreite. Der Film beleuchtet dieses historische Ereignis sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene: Im Kongo selbst entspinnt sich nach der Unabhängigkeit ein Vierkampf zwischen Lumumba als Premierminister, Joseph Kasa-Vabu als Staatspräsident, Joseph-Désiré Mobutu als Anführer des Militärs und Moïse Tshombe als Präsident der reichen Teilrepublik Katanga. Parallel zu diesen Auseinandersetzungen finden in den Sitzungen des UNO-Parlaments Abstimmungen über die Anerkennung des Kongos sowie dessen weitreichende geopolitische Bedeutung für Afrika statt. Belgien und die USA setzen dabei alles daran, Lumumbas Pläne zu durchkreuzen, während sich die Sowjetunion und der innerhalb der UNO neu entstandene afrikanisch-asiatische Block auf dessen Seite schlagen.
Grimonprez montiert sich durch diese historischen Konstellationen mit agitprop’schem Gusto. Rauschhaft reiht der Film zeitgenössische Newsreels, Gremiensitzungen, Amateurfilme und vereinzelt auch klassische Interviews aneinander und durchsetzt diese Bilderflut mit einer Zitatwut aus Zeitungen, Audioaufnahmen, Büchern und anderen Quellen. Den passenden Soundtrack liefert der Jazz der 60er, wobei Grimonprez neben dem amerikanischen Establishment (Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, Duke Ellington, Max Roach, Abbey Lincoln, Nina Simone) auch dem Jazz des Kongos (Le Grand Kallé, Rock-a-Mambo, Nico Kasanda) eine Bühne gibt. Dabei gleicht sich die Montage des Films oft den Rhythmen der Musik an und spielt auf spannungsreiche Art mit deren klanglichen Verlagerungen.
Und wieder steigt jemand lächelnd aus einem Flugzeug

Doch Grimonprez will mehr, als ein bestimmtes historisches Kapitel auf mitreißende Art zu präsentieren. Die Ereignisse werden hier zwar chronologisch nacherzählt, aber gleichzeitig wird das Geschehen im Kongo in einen globalen Rahmen eingebettet – was zu zahlreichen Nebensträngen führt: Nikita Chruschtschow besucht die Vereinigten Staaten; Fidel Castro besucht Harlem; Louis Armstrong soll im Auftrag der US-Regierung in Russland auftreten, verweigert dies aber wegen der anhaltenden Rassentrennung im eigenen Land; Nina Simone tritt in Nigeria auf (was sich als verdeckte CIA-Operation herausstellt); Dizzy Gillespie versucht sich in den USA als Präsidentschaftskandidat; in Belgien heiratet irgendein König oder Prinz; Armstrong tritt im Kongo auf (was sich als ebenfalls als verdeckte CIA-Operation herausstellt); und Malcom X reitet auf einem Kamel durch Nassers Ägypten. Am Ende des Films hat man für ein Leben genug Aufnahmen von Menschen gesehen, die lächelnd aus einem Flugzeug steigen.
Dass Agitprop mehr auf den reinen Affekt als auf die didaktische Wirkung abzielt, ist Teil seines Charms, aber die tatsächlichen Thesen des Filmes bleiben dann doch etwas unterentwickelt. Allzu platt führt der Film vor, dass ein Friedenscorps selten Frieden bringt und dass die UNO, wie alle Institutionen, im Zweifelsfall ihren Selbsterhaltungstrieb über die eigenen hehren Ziele stellt. Man darf sich auch fragen, wie weit Grimonprez diese Sitzungen tatsächlich als das Politiktheater entlarvt, das sie sind, und wie weit er hier nur bekannte Sehmuster verstärkt. Am interessantesten ist Soundtrack für einen Staatsstreich dann, wenn er die tiefen Verflechtungen von lokalen und globalen Strukturen, von wirtschaftlicher und militärischer Macht aufzeigt. Besonders eindrücklich gelingt ihm das anhand des Beispiels der Republik Katanga, die durch Unterstützung der USA und Belgiens zeitweise ihre Unabhängigkeit vom Kongo erklärt: Der Reichtum dieses Landstrichs gründet sich vor allem auf das Vorkommen von Uran, das für den Bau von Atombomben benötigt wird und dessen sich – unter dem Mantel der Union Minière du Haut-Katanga – belgische und britische Geschäftsinteressen zu bemächtigen suchen. Zum Sinnbild dieser Ausbeutung wird William Burden Jr., der in Personalunion CEO einer katangesischen Mine, Präsident des Museum of Modern Art, US-Botschafter in Belgien und CIA-Spion ist.
Ein Lauffeuer der Bilder

Der Kampf im Kongo nimmt sein bekanntes Ende: Lumumba wird von Mobutu festgenommen und stirbt, mutmaßlich in Folge von schweren Misshandlungen. Filmaufnahmen zeigen, wie Lumumba gefangen genommen wird. Grimonprez veranschaulicht ganz unmittelbar die Schnelle, mit der sich diese Bilder verbreiten. Wir sehen, wie Lumumba gefesselt wird, und dann den plötzlichen Blitz einer Kamera. Schnitt zu dem Foto, das von diesem Moment entstanden ist und das nun während einer Kundgebung von einem schwarzen Mann hochgehalten wird. Schnitt zu einem Nachdruck des Fotos, der an der Wand eines großen Büroraums hängt, in dem gerade eine Konferenz stattfindet – man denkt dabei unweigerlich an jenen Konferenztisch, den Grimonprez in einer vorigen Szene als Symbolbild des Kolonialismus ausgemacht hatte, als jenen Ort, der Kongo-Club, an dem weiße, westliche Interessen über ein afrikanisches Land bestimmten. Die Kamera zoomt auf den Nachdruck und der Film schneidet zurück zu der ursprünglichen Filmaufnahme, in der man nun sieht, wie einer der Soldaten versucht, Lumumba zu erniedrigen, indem er ihm ein Stück Papier in den Mund stopft.
Diese Art von medialer Reflexion treibt Grimonprez sogar noch weiter, indem er auch das Kino jener Zeit miteinbezieht. So setzt er seinen eigenen Film bewusst als Kontrapunkt zu den Arbeiten von Gualtiero Jacopetti, dessen Africa Addido (1966) zum Teil im Kongo gedreht wurde und der in einer Szene einen Rebellen zeigte, der vor laufender Kamera von einem Söldner hingerichtet wird. Daneben stehen weitere Szenen aus Agitprop-Werken jener Zeit, wie etwa ein Ausschnitt aus Walter Heynowskis und Gerhard Scheumanns Der lachende Mann (1966), in dem der Söldner Siegfried Müller über seine Zeit im Kongo berichtet. Je länger er redet und lächelt, desto mehr betrinkt er sich und die beiden Filmemacher stellen seinen Worten Ton- und Bildmaterial entgegen, dass das Gesagte als Lüge entlarvt. Der Kontrast, den Grimonprez hier aufmacht, ist vielleicht ein allzu einfacher – schließlich würde heute niemand Mondo-Filme aufgrund ihres dokumentarischen Gehalts verteidigen. Aber es macht durchaus eine Qualität von Soundtrack für einen Staatsstreich, dass sich der Film immerhin versucht, sich zu dieser Tradition in ein Verhältnis zu setzen.
Der Film steht bis zum 11.09.2025 in der Arte-Mediathek.
Neue Kritiken

Die Reise von Charles Darwin

Der große Wagen

Ella McCay

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo
Trailer zu „Soundtrack für einen Staatsstreich“

Trailer ansehen (1)
Bilder



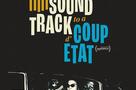
zur Galerie (6 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.

















