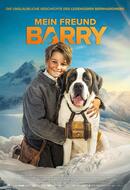Sieben Winter in Teheran – Kritik
VoD: Eine junge Frau wehrt sich gegen einen Vergewaltiger. Dafür wird sie im Iran zum Tode verurteilt. Eine reale Geschichte ist Anlass für Steffi Niederzolls bewegenden Dokumentarfilm, der in leisen Bildern davon erzählt, wie das Private politisch wird.

Im Jahr 2007 wird in Teheran eine 19-jährige Studentin verhaftet. Ihr Name ist Reyhaneh Jabbari. Sie hat einen Mann erstochen, der sie mit falschen Jobversprechen in eine leerstehende Wohnung lockte, um sie dort zu vergewaltigen. Mit einem Messer wehrt sie sich gegen den Angreifer – Notwehr also. Trotzdem klagt man sie wegen Mordes an. Im Prozess werden entlastende Beweise unterdrückt, Strafverteidiger nicht zugelassen, Falschaussagen erpresst, wohlwollende Richter durch Hardliner ersetzt. Denn der Getötete, so stellt sich heraus, war ein streng religiöser, gut vernetzter Geheimdienstler, dessen Ansehen geschützt werden soll. Dafür verurteilt man eine unschuldige Frau zum Tode.
Doch ihre Familie lässt sich nicht einschüchtern. Es gibt Proteste, Online-Petitionen, Appelle von internationalen Menschenrechtsorganisationen. Das Regime deutet an, dass Gnade möglich sei, wenn die Verurteilte den Vergewaltigungsvorwurf widerruft. Doch Reyhaneh bleibt bei der Wahrheit. Am 25. Oktober 2014 wird sie hingerichtet. Erhängt im Morgengrauen nach sieben Jahren Haft in einem der schlimmsten Gefängnisse des Iran.
Monologe, Interviews, Modelle

Soweit die Fakten. Und eigentlich der perfekte Stoff für eine große Kino-Tragödie. Doch Steffi Niederzoll macht aus Reyhanehs Geschichte kein rührseliges Melodram und auch keinen Agit-Prop-Film mit geballter Faust und Woman-Life-Freedom-Sprechchören. Ihr Dokumentarfilm Sieben Winter in Teheran erzählt mit leisen Tönen, Interviews, Homevideos und alltäglichen Staßenszenen von den Abgründen des iranischen Regimes.
Zunächst einmal sieht man kichernde Teenager, die rumalbern, Partys feiern, einen Hund im Arm halten, mit Papa schmusen. Was man so filmt mit dem Handy zuhause. Das Lachen der Jabbari-Mädchen ist ansteckend, die Haare unverschleiert. Aus dem Off spricht dazu eine Frau – es ist die Stimme der iranischen Schauspielerin Zar Amir-Ebrahimi (zuletzt zu sehen in Holy Spider), die aus Reyhanehs Briefen aus der Haft liest. Darin beschreibt sie ihr unbeschwertes Leben vor der Tat, die Umstände, die zu ihrer Verhaftung führten: die Angst, die Verhöre und Misshandlungen, die zunehmende Verzweiflung und schließlich die Einsicht, dass sie aus diesem Albtraum nicht mehr lebend rauskommt. Sehr persönliche Texte, die so schnell nicht wieder aus dem Kopf gehen.
Diese Monologe verwebt der Film mit Interviews, in denen Eltern und Schwestern, ein Anwalt und eine Mitgefangene rückblickend erzählen, wie sie die Situation erlebt haben. Auch visuell führt uns Niederzoll an die Orte des Geschehens zurück. Wir sehen Bilder auf Teheran, Alltagsszenen in den Straßen, das Polizeigebäude, in dem Reyhaneh zuerst festgehalten wurde, Wachleute vor dem berüchtigten Evin-Gefängnis. Andere Schauplätze, zu denen sie keinen Zugang hatte, wie die Gefängniszellen und den Gerichtssaal, lässt die Regisseurin als Modelle nachbauen und filmt sie ab.
Solidarität im Knast

Das sind alles keine spektakulären Bilder. Oft handelt es sich um wackelige Handyclips aus dem fahrenden Auto oder mit versteckter Kamera gedreht, manches dramatisch, anderes sehr privat: Doch durch die Unmittelbarkeit erzeugt das Material seinen eigenen Sog. Wir sind beim ersten Besuch im Gefängnis dabei, hören das Telefongespräch der Mutter mit dem Sohn des Vergewaltigers, sehen, wie sie bei einer Verkehrskontrolle die Fassung verliert. Obwohl der schreckliche Ausgang der Geschichte feststeht, fiebern wir mit den Jabbaris mit und halten den Atem an, wenn die Familie im Auto vor dem Gefängnis vergeblich auf ein letztes Wunder hofft.
Im Laufe des Films werden wir so allmählich auch Zeugen erstaunlicher Transformationsprozesse. Aus den verängstigten Eltern werden couragierte Regimekritiker, aus einem naiven Mädchen eine starke Frau, die sich von den brutalen Mullahs nicht brechen lässt. Im Gefängnis habe sie nicht nur das Schlimmste, sondern auch das Beste erlebt, schreibt sie über ihr Coming-of-Age im Knast. Dort erlebt sie Gemeinschaft und Solidarität mit anderen Frauen, die wie sie der verkorksten Ideologie des Regimes zum Opfer gefallen sind. Und sie begreift, dass ein Staat, der missbrauchte Kinder als Prostituierte verurteilt, während die Männer, die diese Kinder vergewaltigt haben, unbehelligt bleiben, sein moralisches Kapital verspielt hat. Das verleiht dem Film trotz der niederschmetternden Geschichte sogar so etwas wie ein hoffnungsvolles Ende. Die Mullah-Richter konnten Reyhaneh nicht zum Schweigen bringen. Im Gegenteil. Mit ihrer Hinrichtung ist sie endgültig zur Märtyrerin geworden – wie Masha Amini zum Vorbild derer, die auf den Straßen Irans protestieren.
Die letzte Geisel

Die Brutalität und Frauenfeindlichkeit des iranischen Regimes sind gerade wieder große Themen – auch im Kino. Man denkt an die Filme von Shirin Neshat oder an Massoud Bakhshis Thriller Yalda, der von einer zum Tode verurteilten Frau handelt, die in einer iranischen Reality-TV-Show vor laufender Kamera um Gnade bitten soll. Mit seiner improvisierten Ästhetik steht Niederzolls Dokumentarfilm jedoch eher in der Tradition oppositioneller Filmemacher wie Jafar Panahi, der bis vor kurzem selbst im Evin-Gefängnis einsaß und im Home Movie-Style über seinen Prozess (This Is not a Film, 2011) oder das Leben als Taxifahrer (Taxi Teheran, 2015) erzählt.
In der jetzigen Situation ist es im Iran noch riskanter geworden, irgendwo ohne offizielle Drehgenehmigung zu filmen. Schon für paar harmlose Handyshots kann man verhaftet werden. Umso mehr Respekt gebührt den anonymen Kameraleuten, die das Material, das Niederzoll in ihren Film verwendet, in Teheran gedreht und außer Landes geschmuggelt haben. Auch die Jabbaris sind große Risiken eingegangen, indem sie ihre privaten Filmschnipsel und heimlichen Mitschnitte öffentlich machen. Zwar konnten Mutter und Töchter das Land inzwischen verlassen, doch dem Vater wird weiterhin die Ausreise aus dem Iran verweigert. Das ist noch so eine perfide Strategie des iranischen Unterdrückungsapparats: Man behält immer eine Geisel.
Doch Sieben Winter in Teheran ist dadurch nicht mehr stoppen. Reyhanehs Geschichte ist in der Welt. Sie lässt das Mullah-Regime ganz schlecht aussehen. Und macht denen Mut, die sie über kurz oder lang stürzen werden. Auf der Premiere in Berlin gab es Standing Ovations.
Der Film steht bis 12.09.2024 in der ARD-Mediathek.
Neue Kritiken

No Bears

Scarlet

Marty Supreme

Father Mother Sister Brother
Trailer zu „Sieben Winter in Teheran“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (6 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.