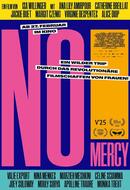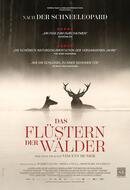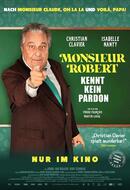Searching for Oscar – Kritik
Was wenn? Vor die beschlagenen Brillengläser eines Filmkritikers betritt das Publikum, ganz unscheinbar, den roten Teppich, isst vom Büffet, trinkt durcheinander. Keinen interessiert’s.

Anliegen der diesjährigen Woche der Kritik ist die Frage nach dem Publikum: Was ist damit gemeint, wenn man etwa von einem Publikumsfestival spricht, oder – viel spannender – wie könnte es sonst noch gemeint sein? Die Veranstalter glauben, dass Kino echte Debatten auslösen sollte, und mit dem Versprechen einer Diskussion setzen sie die Möglichkeit einer solchen zunächst einmal voraus. Die Woche der Kritik denkt sich das Publikum also als ein räsonierendes oder wünscht es sich zumindest als solches. Dass man darüber aber stets nur in der dritten Person spricht, als gäbe es a priori keinen gemeinsamen Raum, ist bezeichnend für die tricky questions, die bei dieser Veranstaltung nun schon zum vierten Mal Programm sind. Was das Publikum will (insofern der Singular als grammatische Kategorie die epistemische Last in diesem Falle noch tragen kann), was es begehrt, woran es ihm mangelt und wie es überhaupt gedacht werden kann – das sind alles andere als triviale Fragen. Wäre es nicht hilfreich, für den Einstieg das Ganze ein wenig zurückzufahren? Ich glaube, das Publikum selbst, wie etwa auch die öffentliche Meinung, ist ein Desiderat, eine Lakune, eine Fiktion. „Nicht wirklich, aber wirksam“, notwendig für Träume, die nicht von ihm selbst, sondern von verschiedenen Anderen geträumt werden.
Der emanzipierte Filmkritiker

Der im guten Sinne müde Dokumentarfilm von Octavio Guerra nimmt sich dieses Nichtige des Publikums zum Gegenstand. Ob ihm das bewusst oder doch eher beiläufig passiert, tut nichts zur Sache. In Searching for Oscar begleitet er Oscar Peyrou, den Präsidenten der spanischen Filmkritikervereinigung, von einem Filmfestival zum anderen. Der filmische Oscar fliegt mit Flugzeugen, geht durch Hotelflure, liegt dort auf Betten, frühstückt, gibt Workshops, beantwortet schale Fragen immer freundlich mit sí, muy bien. All diese Orte verschwimmen für uns und für Oscar in eins, sein Unterscheidungsvermögen scheint stark lädiert. Unser Oscar ist viele Dinge: eine Identifikationsfigur, ein Antiheld und das Fremde in uns selbst, das wir lieber in den inneren Keller verbannt hätten. Doch ist er auch ein wahrer Künstler und ein Protoliterat, denn überwiegend sehen wir ihn in Jacuzzi und beim Sonnenbaden, beim Essen, beim Rasieren. Was macht es mit uns? Macht es die Ergebnisse seiner Arbeit für uns möglicherweise noch fantastischer? Die Antwort ist ja. Im Zentrum seiner Schreibmethode über Filme, die er sich allesamt konsequent nicht anschaut, steht nichts anderes als Fiktion und Fabulieren. Als emanzipierter Zuschauer setzt er hier ganz auf Distanz und beschäftigt sich lieber mit Paratexten, seien es Filmplakate oder die Namen der Schauspieler.
Open house für das Publikum!

Unser Oscar träumt von einem nicht existierenden Film, von anderthalb Stunden schwarzer Leinwand. So ein Film, wenn es ihn gäbe, wäre freilich keine einfache Nichtigkeit. Ein Film, den es nicht gibt oder der gerade hinter verschlossener Tür läuft, und ein Filmkritiker, der diesen Film nicht sehen kann oder will – dazwischen ist alles möglich. Keine nach Zahlen malenden Anstalten, keine Instanzen, die bevormunden oder herausfordern wollen – open house! In diesem Nichts herrscht eine permanente Krise – des Kinos, der Kritik – und genau hier (was wenn?!) tritt das begehrte Publikum endlich auf die Bühne. Dort, wo keiner auf es wartet, schlendert es auf verlassenen red carpets unbedeutender Filmfestivals, isst vom Büffet, trinkt durcheinander. Gibt es ein geteiltes Interesse, einen Gemeinsinn, oder setzt es sich nicht viel eher auf Basis des Zufalls, der Trägheit oder der Gleichgültigkeit zusammen? Und wenn sich dieses in Erscheinung getretene Wir des Publikums zu Wort meldete, was würde es dann sagen? Zum Beispiel Folgendes: „Wir, das Publikum, interessieren uns nicht dafür, wer Oscar ist, sei er auch nicht irgendwer, oder was FIPRESCI ist, sei sie auch nicht irgendwas. Wir haben keinen Sinn fürs allzu Sublime, keine Lust auf Sarkasmus, Insiderwitze und das übrige Wissen, das uns stets unterstellt wird. Das Buch mit dem Titel Das anarchische Kino kennen wir nicht und sind keinesfalls im Begriff, diese Tatsache jemals zu ändern. Filme schauen – wozu? Wir, das Publikum, nehmen es mit der Idee der ‚literarischen‘ Kritik wörtlich, wir lesen in den Farben der Plakate, hören hinein in die Prosodie der Titel, lassen uns auf Empfindungen und Launen ein.“

Und so zum Beispiel zeigt das Publikum seine weibliche Seite: „Kauft uns einen Drink, sagt es, und wir werden sanft zu euch sein, wir lassen unsere Beziehungen zu euren Gunsten spielen. Wir hören euch zu, und wie Frauen es tun, nicken wir, aber immer nur als Zeichen der Ermutigung, nie der Zustimmung. Dissense und Konsense sind einerlei, es geht ums Fortbestehen, um das bloße Am-Leben-Erhalten dessen, für das uns und euch noch keine Begriffe zur Verfügung stehen.“ „Wir wollen keine Reisenden mehr sein“, sagt das Publikum, „und auch keine naiven Touristen. Die Maschine rotiert, wie Adorno schon sagte, ohnehin auf der gleichen Stelle.“ Searching for Oscar sollte man beim Wort nehmen. Sich einen Reim darauf zu machen macht dann ganz schön Spaß.
Neue Kritiken

Marty Supreme

Father Mother Sister Brother

The Day She Returns

Prénoms
Trailer zu „Searching for Oscar“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (5 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.