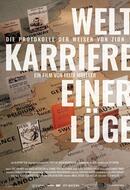Runner Runner – Kritik
Langeweile in der Steueroase.

In einem Film zum Thema Onlinepoker sehen wir das eigentliche Zocken nur in einer einzigen Szene. Dann aber gleich als audiovisuellen Rausch: Richie Furst (Justin Timberlake) sitzt am Küchentisch, während seine Collegekumpels biersaufender- und ratschlaggebenderweise um ihn herum defilieren. Die Kamera kreist dynamisch um die Meute, mit Furst in der Mitte, der die vier (oder sechs?) gleichzeitig geöffneten Tische auf seinem Flatscreen anstarrt. Mittels unsichtbarer Schnitte wirbelt sich die Kamera in einen Montagetaumel: Während einer anfänglichen Siegesserie kocht die Party, doch bald läuft etwas schief. Furst verliert gegen einen nur scheinbar trottelhaft agierenden Mitspieler, und am Ende sitzt er alleine in der zugemüllten Bude – bankrott, gedemütigt und kurz vor dem Rausschmiss aus Princeton. „Keine Emotionen, pure Mathematik“ lautet sein Credo. So soll die Gewinnmarge kontrolliert werden. Was aber, wenn der Spielverlauf gegen die Statistik verstößt? Glück und Pech sind Begriffe einer schwachen, weil schicksalsergebenen Natur. Betrug ist die einzig rationale Erklärung.

Wie in der mittlerweile berühmt gewordenen Eröffnungssequenz von The Social Network (David Fincher, 2010), zu dem sich Brad Furmans Runner Runner nicht nur mit der Wahl seines Hauptdarstellers und der Eröffnungssequenz in der Ivy-League-Welt immer wieder in Bezug setzt, soll hier eine filmisch sterbenslangweilige, weil essentiell aus Klicken, Denken und Starren bestehende Handlungssituation attraktiv für die Leinwand aufbereitet werden. Aber die Pokerszene in Runner Runner kommt Finchers dichtem metaphorischem Hütchen-Wechsel-Dich-Spiel aus virtuellem und realem Campusleben nicht einmal nahe. Sie bleibt ein eher kläglicher Versuch, etwas von der prunkvollen Parvenü-Kultur des Spielcasinos auch hinter dem Computerbildschirm zu versammeln.
Dabei startet Runner Runner seine Erkundung der halbseidenen Geschäfte im digitalen Poker-Biz mit einem Figurenentwurf, der satt ist an bedenkenswerten Verbindungen zu aktuellen wie prinzipiellen Problemen Amerikas. Denn in die Lage, sich die horrenden Studiengebühren für die Elite-Uni per Zockerei verdienen zu müssen, ist der hochbegabte Furst nur geschliddert, weil er beim „Meltdown“ des amerikanischen Finanzsystems anno 2008 seinen Job als Spekulant verloren hatte. Weil das Gambling an der Wall Street seitdem riskanter ist als der brave Weg durch die Ausbildungsstufen, wurden die Pferde eben umgesattelt.

„Everybody gets a fair shot, whether he bets one dollar or a million“: In einem Film, der nie verlegen ist um sorgsam ausgestreute Binsenweisheiten, fasst nichts das Dilemma seiner Hauptfigur wie seines Gesellschaftsmodells besser zusammen als Fursts Schwur auf die Gerechtigkeit des Wettens. Denn natürlich bekommt der Arme niemals einen „fair shot" – es sei denn, er hat eine eher schwache Meinung von Moral und Gesetz und eine Vorliebe für den ellenbogenbewehrten Gang zum Reichtum. Das weiß jeder Ottonormalbürger in einer Marktwirtschaft selbstredend schon immer. Aber Furst, der nach dem Großreinemachen in der kriminellen Hochfinanz noch immer verletzt scheint in seinem Alphamännchenstolz, muss die Lektion auf die harte Tour lernen.

Also setzt er „alles auf eine Karte" (auch an Pokermetaphern fürs Leben und Arbeiten mangelt es hier niemals) und fliegt dahin, wo das digitale Geld verwaltet wird, und wo er sich Aufklärung erhofft für den erlittenen Betrug: nach Costa Rica, zu Ivan Blok (Ben Affleck), dem König der virtuellen Spieltische. Das nun folgende Szenario – naiver Karrierist in den Fängen eines kriminellen Gurus – hat sich Runner Runner eins zu eins bei Wall Street (Oliver Stone, 1987) entliehen, inklusive spätem (aber nicht zu spätem) Durchschauen der illegalen Strukturen und Rache am ehemaligen Vorbild. Das ist allerdings beileibe keine schlechte Schablone, und für einige Einblicke in den semilegalen Offshore-Imperialismus reicher Ökonomien ist sie vielleicht sogar optimal. Wie in besten Bananenrepublik-Zeiten schmiert Blok die karibischen Staatsdiener mit seinem niemals endenden Geldstrom, während Furst aus der anfänglichen Euphorie über soviel schnelles Geld und scharfe Frauen erst zeitverzögert mit dem ethischen Nachfragen beginnt. Runner Runner spielt dabei indirekt auf Geldwäscheskandale um die Pokerplattformen Full Tilt und Pokerstars an.
Doch der Film schafft es nie, die angerissenen Stränge – Schattenindustrien in Steueroasen, Big-Data-gestützte Glücksspielindustrie, das ewige Zocken namens Kapitalismus, das ungerechte Ausbildungssystem der USA – zu einem starken Bündel zu verschnüren. Sogar als bescheidener Finanzthriller versagt er. Während der Zuschauer sich die expressiven, kinetischen, auch agitatorischen Gesten eines Oliver Stone (ca. Wall Street 2, 2009) wünscht, dümpelt Runner Runner von einer Zwei-Personen-Dialogszene zur nächsten. Überall stehen, liegen und sitzen sich nahezu immobile Figuren gegenüber, am Strand, an der Hotellobby, am Swimmingpool.

Am meisten leidet unter Furmans Regiestil Justin Timberlake. Wo sein Tänzerkörper stillgestellt ist, von den dominierenden Halbnahen sogar aus dem Kader verdrängt wird, da treten seine Mühen beim Versuch psychologisch mitteilsamen Sprechens brutal zutage. Nicht, dass es ihm das zwanghaft allegorische und plauderhafte Drehbuch leicht machen würde. Aber wenn man sich schon nach der Hälfte des Films wieder zurücksehnt nach der einen, für sich genommen belanglosen Szene, in der es aber wenigstens mal um das ging, was sonst immer nur bequatscht wird, und in der der Leading Actor von einer entfesselten Kamera überrannt wurde, dann hat man entschieden zu viel Zeit mit einem zu langweiligen Film verbracht.
Neue Kritiken

Zoomania 2

Die Entführung

Satanische Sau

Wicked: Teil 2
Trailer zu „Runner Runner“


Trailer ansehen (2)
Bilder




zur Galerie (20 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.