Reich des Bösen - Fünf Leben im Iran – Kritik
Reich des Bösen will zeigen, wie die iranische Gesellschaft, ungetrübt vom westlichen Medienbild, wirklich aussieht. Regisseur Mohammad Farokhmanesh hat dafür fünf Menschen im Iran durch ihren Alltag begleitet.

Seit der islamischen Revolution 1979 ist der Iran in westlichen Ländern zum Feindbild geworden. Atomare Ambitionen, gepaart mit antisemitischen und antiamerikanischen Äußerungen des Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad, verschärfen das Misstrauen gegenüber dem Land noch zusätzlich. Dabei geht die mediale Repräsentation der iranischen Bevölkerung meist vollständig unter. Abgesehen von wenigen Ausnahmen kommt die iranische Öffentlichkeit meist als wütende Masse vor, die auf Bildern des US-Präsidenten herumtrampelt oder israelische Fahnen verbrennt.
Reich des Bösen unternimmt den Versuch, dieses medial vermittelte Bild der iranischen Gesellschaft zu korrigieren. Farokhmanesh stellt sich mit seinem Dokumentarfilm gegen das Stereotyp einer obrigkeitshörigen Massengesellschaft, indem er die Heterogenität innerhalb des Iran betont. Dabei ist er um Ausgewogenheit bemüht. Im Zentrum seines Films steht das Leben von fünf untereinander unbekannten Personen: zwei Frauen, zwei Männer und ein siebenjähriges Mädchen. Ihre Geschichten verlaufen episodisch nebeneinander her. Die beiden Frauen sind aus unterschiedlichen Gründen mit den politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen in der islamischen Republik nicht einverstanden, während die beiden Männer die Situation im Iran akzeptieren oder sogar unterstützen. Mit diesen Problemen kommt die kleine Golsa – wenn überhaupt – nur sehr zaghaft in Berührung. Die Auswirkungen von Themen wie Religion, Politik oder Frauenrechte auf ihre Entwicklung sind vorerst nur zu erahnen.

Wie das Schema des Films bereits nahelegt, steht die staatliche Unterdrückung von Frauen im Zentrum der Kritik. Dabei wird vor allem die Absurdität der Vorschriften deutlich, die den Umgang von Männern und Frauen miteinander regeln. Die Studentin Setayesh nimmt als Amateur-Fechterin regelmäßig an Wettkämpfen teil. Ihr Mann durfte ihr allerdings noch nie dabei zusehen, denn Männern ist es verboten, Sportveranstaltungen, ja sogar das Training der Damenmannschaft zu besuchen, obwohl das Paar fast täglich gemeinsam im Park Sport treibt. Auch ist es für Setayesh nahezu unmöglich, an internationalen Wettkämpfen teilzunehmen. Zwar ist das nicht per se verboten, doch während des Fechtens muss sie über dem Anzug, der ihren Körper ohnehin schon lückenlos bedeckt, noch einen Umhang tragen und ist damit gegenüber den anderen Sportlerinnen massiv benachteiligt. Setayesh und ihre Mannschaftskameradinnen begegnen diesen Vorschriften mit resigniertem Zynismus.
Im Gegensatz zu Setayesh hält Herr Meidani diese Gesetze für legitim. Er sieht sie sogar als essenziell für das friedliche Zusammenleben, und das liegt ihm – wie er nicht müde wird zu betonen – besonders am Herzen. Neben der Leitung seiner privaten Sprachschule ist er der Imam einer schiitischen Gemeinde. Die Religion oder vielmehr deren Interpretation durch die iranische Führung bestimmt sein Leben. Herr Meidani wirkt bedrohlich falsch. Er kann in der Moschee als antiwestlicher „Hassprediger“ auftreten, hat aber im nächsten Moment schon wieder, wie eine Maske, sein gefrorenes Lächeln aufgesetzt und referiert über das friedliche Miteinander aller Menschen.

Die interessanteste Figur des Films ist Golsa, da sie aus dem grundlegenden Gut/Böse-Narrativ herausgelöst ist. Sie steht sinnbildlich für ein weiteres Anliegen des Films: Wenn Farokhmanesh sie filmt, wie sie mit großen Augen durch die Spielzeugabteilung eines Einkaufszentrums läuft, von ihrem Berufswunsch berichtet, Sängerin zu werden oder in der Musikschule „Guten Abend, gut’ Nacht“ mit deutschem Text singt, macht er auf die Gemeinsamkeiten der Menschen im Iran und in den westlichen Ländern aufmerksam und nimmt dem Iran den Anschein des grundsätzlich Fremden.
Reich des Bösen ist nicht der erste Film, der mit dem medialen Bild des Golfstaates bricht. Marjane Satrapi beschäftigte sich etwa in Persepolis (2007) mit der politischen Situation im Iran, der Film funktionierte dabei aber vollkommen anders. Während Persepolis sich als Biopic und zusätzlich in Comic-Form als dezidiert subjektive Erzählung präsentiert, erhebt Reich des Bösen den Anspruch der Objektivität. Natürlich ist es angesichts der staatlichen Repression gegen Frauen im Iran nahezu unmöglich und ebensowenig wünschenswert, als Filmemacher objektiv zu bleiben. Die männlichen Figuren sind dennoch zu holzschnittartig und nehmen dem Film damit einen Teil seiner Glaubwürdigkeit als Querschnitt der iranischen Gesellschaft.

Reich des Bösen ist in seiner Anlage ein konventioneller Dokumentarfilm, der sich der Notwendigkeit einer adäquaten medialen Repräsentation der iranischen Gesellschaft annimmt und dabei interessante Bilder aus einem faszinierenden Land liefert. Im Vordergrund steht aber seine Botschaft, und die vermittelt er leider mit dem Holzhammer.
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Trailer zu „Reich des Bösen - Fünf Leben im Iran“

Trailer ansehen (1)
Bilder
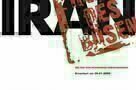



zur Galerie (16 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.






