Pinocchio – Kritik
Bewusstsein und Materie: In seiner Neuverfilmung des Klassikers reiht Matteo Garrone Abenteuer an Abenteuer, aber Pinocchio durchzieht auch eine fundamentale Verunsicherung und eine Sehnsucht nach Verwandlung.

Der Holzblock bewegt sich von selbst über den Steinboden, noch bevor ihn ein menschliches Werkzeug berührt hat. Später, als der Schreiner Geppetto sich daran macht, aus dem Holzstück eine Puppe zu schnitzen, beginnt sich dessen raue Oberfläche schon in regelmäßigen Atemzügen zu heben und zu senken, noch bevor die Figur Augen, Beine, ja überhaupt eine eindeutig menschliche Form hat. Als die Puppe schließlich fertig ist, schaut der Handwerker seinem Geschöpf tief in die neugierigen Augen und fragt mit unsicherer Stimme: „Gefällt dir, wie ich dich gemacht habe?“
Das Unberechenbare als Regelfall

Es ist eine tiefe ontologische Unsicherheit, die sich durch die ersten Szenen von Matteo Garrones Neuverfilmung des Kinderbuchklassikers Pinocchio von Carlo Collodi zieht. Pinocchio lebt, noch bevor überhaupt feststeht, als was. Und Geppetto ist plötzlich an ein fremdes Wesen gebunden, dem er erst noch seine Form geben muss. Anders als andere Väter ist Geppetto nicht nur verantwortlich dafür, wie es seinem Kind geht, sondern auch dafür, was dieses Kind ist bzw. dass es überhaupt ein Kind und nicht etwa ein Vogel oder ein ganz anderes, gerade erst erdachtes Wesen ist. Das Bewusstsein wird in Garrones Film nicht an eine stabile Basis gekoppelt, an eine angestammte Trägersubstanz, vielmehr tritt es auf ganz verschiedene Arten in Erscheinung, die nie wirklich klar voneinander getrennt sind.

Auch der genaue Status der magischen Wesen und Ereignisse bleibt in Garrones Film beständig in der Schwebe: Der Anblick der lebendigen Puppe Pinocchio entlockt den Menschen immer wieder ein ungläubiges Staunen, obwohl sie eigentlich in einer Welt leben, in der sprechende Fische, holde Waldfeen und moralisierende Grillen ein ganz selbstverständlicher Teil des Alltags sind. Die vorgeblich normalen Marionetten, auf die Pinocchio in einer Szene trifft, hängen zwar an Schnüren, die sie überallhin verfolgen, scheinen aber dennoch nicht weniger lebendig und selbstbestimmt als Pinocchio selbst zu sein. Die Unterscheidung zwischen dem Realen und dem Magischen, wie sie die Figuren in Garrones Film immer noch machen, hat keine sichtbare Grundlage in der tatsächlichen Beschaffenheit der Welt. In dieser Unterscheidung spürt man somit vor allem den inneren Zwang, an der Vorstellung einer berechenbaren Wirklichkeit festzuhalten, auch wenn das Unberechenbare längst zum Regelfall geworden ist.
Ein leicht ablenkbarer Blick

Diese inneren Widersprüche und Spannungen, in denen der märchenhafte Tonfall des Films etwas Beunruhigendes und Ominöses bekommt, sind das mit Abstand Faszinierendste an Garrones Pinocchio. Doch sie bleiben nur kurze Schatten, die den Film in seinem zunehmend überhasteten Vorwärtsdrängen kaum beeinträchtigen. Denn sobald Pinocchio Gepetto in seiner Werkstatt sitzen gelassen hat und zu allerlei Abenteuern in die weite Welt aufgebrochen ist, macht sich der Film die hyperaktive und leicht ablenkbare Energie seiner Titelfigur allzu sehr zu eigen. Abenteuer reiht sich an Abenteuer, Begegnung an Begegnung, ohne dass der Film auf das Spezifische der Ereignisse je wirklich eingehen würde. Im Grunde verlaufen diese einzelnen Episoden stets nach demselben Muster: Die Grundsituation wird in der einen Szene etabliert, nur um in der nächsten sofort wieder aufgelöst zu werden. Auf das Setup folgt direkt die Pointe, auf den Auftakt immer gleich der Schlussakkord. Was fehlt ist die Durchführung, in der die umrissene Situation neu betrachtet und neu bewertet, in der sie abgewandelt und ausgedeutet wird.
Schlendern durchs Maskenkabinett

Emsig ist Garrones Film damit beschäftigt, all die bekannten Stationen auf Pinocchios Reise abzuarbeiten: die Gaunereien von Fuchs und Kater, die Aufenthalte bei der Waldfee, den Ausflug ins Schlaraffenland und die anschließende Verwandlung in einen Esel. Aber in dieser Umtriebigkeit scheint der Film gar nicht zu merken, dass ihn diese Abenteuer gar nicht interessieren, jedenfalls nicht als Abenteuer, als außergewöhnliche Ereignisse, die in einem persönlichen Erleben ihre Wirkung entfalten.

Was den Film stattdessen interessiert, und wo er tatsächlich eine mitreißende Energie entwickelt, ist die Darstellung des Inventars dieser Abenteuer. Neugierig durchblättert der Film verschiedene Landschaften und magische Orte, vor allem aber verschiedene schnörkelhaft ausgeformte Kreaturen. Dabei sind die fantastischen Wesen, die der Film vorführt, in der Regel von einer instabilen Doppelnatur geprägt. So sind Fuchs und Kater nur durch ein paar streng aus dem Gesicht wachsende Schnurrhaare als Tiere erkennbar und so hat ein sprechender Fisch nicht etwa ein computeranimiertes Fischmaul, sondern ein trauriges Menschengesicht. Es ist nicht der Wille zur Ausgestaltung einer in sich geschlossenen Fantasiewelt, der in diesen Auftritten spürbar wird, sondern die Lust an der Verkleidung. Durch dieses ausgestellte Maskenspiel kehrt der Film zurück zu jener Sehnsucht, von der er seinen Ausgang nahm – der Sehnsucht nach Verwandlung, nach einem anderen Körper, nach einer anderen materiellen Basis für das eigene Bewusstsein.
Neue Kritiken

Der große Wagen

Ella McCay

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo

No Other Choice
Trailer zu „Pinocchio“

Trailer ansehen (1)
Bilder
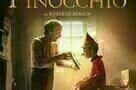



zur Galerie (15 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.
















