Paris Calligrammes – Kritik
VoD: Eine junge Frau fährt in den 1960er Jahren nach Paris, um eine große Künstlerin zu werden. Ulrike Ottingers Paris Calligrammes ist eine autobiografische Spurensuche mit mitunter erstaunlich wenig Distanz.

Der Filmtitel steht vorne auf dem Einband des schwarzen Buches: das Paris handschriftlich und verschnörkelt in Weiß, das Calligrammes aus der Zeitung ausgeschnitten und aufgeklebt. Unter den beiden Wörtern befindet sich auf dem Buchdeckel das Foto eines Mannes am Schreibtisch, im Hintergrund viele Bücherregale, den die weibliche Stimme aus dem Off später als Fritz Picard vorstellen wird. Gealterte Hände, an einem Finger ein Ring mit Edelstein, greifen nach dem Buch, schlagen es auf. Diese Geste, die Paris Calligrammes, eröffnet, ist eine der klarsten filmischen Markierungen dafür, dass nun etwas folgt, was bereits vergangen ist. Ein Rückblick auf ein Stück Lebenszeit, das eine Kapitel, festgehalten auf Papier – und jetzt eben auch auf Film. Zugleich etabliert das Aufschlagen des Buches die Lust am Zurück- und Vorblättern, das Springen zwischen den Zeilen und Zeiten. Und wie man manchmal eine rote Kordel als Lesezeichen bräuchte, um sich in der eigenen Erzählung zurechtzufinden.
Sehnsuchtsort Paris

Der Startpunkt für dieses Stück Lebenszeit ist leicht zu finden: 1962 fährt eine junge Frau mit dem Auto aus der süddeutschen Provinz in Richtung Frankreich, das Ziel ist der Sehnsuchtsort Paris, und die Frau ist fest entschlossen, eine „große Künstlerin“ zu werden, wie sie jetzt, fast 60 Jahre später, per Voice-over erzählt. Die Frau, die junge von damals und die im Voice-over, ist Ulrike Ottinger, Malerin, Fotografin, Theatermacherin, Dokumentar- und Spielfilmmacherin. Bei der diesjährigen Berlinale wurde sie mit der Berlinale Kamera ausgezeichnet, mit der seit 1968 Persönlichkeiten wie Institutionen geehrt werden, die sich um das Filmschaffen besonders verdient gemacht haben. Dieser Erfolg schwebt über Ottingers neuem Film, in dem sie sich mit ihrer Zeit in Paris von 1962 bis 1969 beschäftigt. Hier spricht und dreht eine Person, die es geschafft hat.

„Wie mache ich einen Film aus der Perspektive einer sehr jungen Künstlerin, an die ich mich erinnere, mit der Erfahrung einer älteren Künstlerin, die ich jetzt bin?“, stellt sich Ottinger als Arbeitsfrage für ihren Film. Untrennbar knüpft sie die Station Paris an das eigene künstlerische Schaffen, bei dem alles Erlebte Inspiration sein, verarbeitet werden kann. Die französische Metropole ist dafür wie geschaffen, mit all ihren Menschen, Straßen, Cafés, Galerien, Museen, Kinos und Jazzkellern. „Gehen und Sehen wurde zu meiner aufregendsten Beschäftigung“, sagt Ottinger einmal und beschreibt damit nicht nur die Faszination ihres früheren Selbst für die damalige Großstadt, sondern auch den Zugriff des Filmes mit seiner Lust am Spazierengehen, seinem Flanieren durch zehn Kapitel, bei dem man manchmal länger, manchmal kürzer stehen bleibt, Dinge, Plätze und Personen wiedertrifft oder sie gänzlich aus dem Auge verliert. Dabei besteht Paris Calligrammes sowohl aus Archivmaterial als auch neu gedrehten Aufnahmen von all dem, an dem Ottinger damals wie heute haften geblieben ist. Lose scheint durch Filmausschnitte und Fotos auch ihr eigenes Werk auf.
Die Beiläufigkeit sortieren

In Paris Calligrammes wird Erinnerung erzählbar, indem unterschiedliche Medien miteinander Beziehungen eingehen: das Theater und der Film, die Schrift und das Bild, die Literatur und die Musik, das Kunstwerk, das Ottinger im Rahmen einer Ausstellung zerschneidet und die Besuchenden dazu auffordert, es doch wieder zusammenzusetzen. Der Film selbst nutzt wiederum die in seinem Titel benannte Form des Kalligramms, eines Figurengedichtes. Die zehn Kapitel werden zu zehn Figuren, Entwürfen, Strukturen, die die scheinbare Beiläufigkeit sortieren; wie eben vielleicht auch die Stadtanlage Paris die Bewegungen vorgibt, die sich in ihr durchführen lassen. All das macht Ottinger selbst ebenso als Figur und Künstlerin sichtbar, die in verschiedenen Disziplinen arbeitet. Als Frau um die 20 in Paris ist sie schließlich selbst intermedial unterwegs, bewegt sich in unterschiedlichsten sozialen Kreisen, lernt Radiertechniken im Studio des Grafikers Johnny Friedlaender und hängt danach in der Cinémathéque Française bei Henri Langlois ab. Immer wieder sucht sie in Paris Calligrammes nach Überschneidungen, den Treffpunkten der unterschiedlichen Straßen.

Einer davon ist Fritz Picards Librairie Calligrammes, die eine zentrale Rolle einnimmt und an die der Titel von Ottingers Film angelehnt ist. Das Antiquariat, das Picard nach seiner Emigration eröffnete und in dem sich zunächst vor allem deutschsprachige Literatur fand, die er vor der nationalsozialistischen Bücherverbrennung gerettet hatte, zeigt Ottinger als intellektuellen Begegnungsort einer französischen und deutschen Szene, wo man Zigaretten, Kaffee und Gedanken teilte; ein „Ort, an dem die Hoffnung aufschien, eine brutal aus den Angel gehobene Welt wieder zusammenzubringen“. Ein Gästebuch des Ladens, deren Widmungen und Signaturen in Paris Calligrammes wiederholt herbeigezogen werden, dient dafür als Beweisstück. Annette Kolb, Raoul Hausmann, Walter Mehring, Paul Celan und viele andere haben sich hier verewigt. Es lohnt mitzuschreiben.
Die allzu eigene Position

Wie bei der Librairie Calligrammes versucht Ottinger ihren Aufenthalt in Paris kontinuierlich mit politischen Themen der Zeit zu verschränken. So widmet sich eines der Kapitel bespielweise den Demonstrationen der algerischen Befreiungsbewegung, in der sich Freund*innen Ottingers engagierten, und der drastischen Polizeigewalt, die dieser entgegenschlug. Bis heute wurden die Übergriffe unter Polizeichef Maurice Papon, der während der deutschen Besatzung Frankreichs noch für die Organisation der Deportation von Menschen jüdischen Glaubens verantwortlich war, nicht aufgeklärt. Die französische Kolonialgeschichte Frankreichs liegt derweil in Paris Calligrammes über allem. Ottinger benennt diesen Aspekt an vielen Bauwerken, vor denen sie damals stand und die wir heute gefilmt sehen.
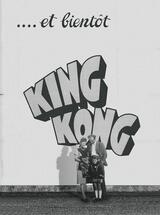
„Um die eigene Kultur zu kennen und zu verstehen, muss man lernen, sie vom Standpunkt einer anderen aus zu betrachten“, meinte der Ethnologe Claude Lévi-Strauss in einer der Vorlesungen, die Ottinger in ihren Pariser Jahren besuchte. Und es ist ein erstaunlich blinder Fleck in Paris Calligrammes, dass Ottinger ihr filmisches Interesse an außereuropäischen Kulturen und ihren, wie sie ihn selbst in einer Kapitelüberschrift nennt, „ethnografischen Blick“ nicht weiter befragt. Wenn sie fasziniert von ihren „Entdeckungsreisen in die Welt“ spricht oder die Kamera auf schwarze Menschen beim Flechten von Haaren richtet und dieses Handwerk als den einzigen Beitrag der ehemals Kolonisierten zu einer Kulturproduktion versteht, die bis dato nur als das Werk großer europäischer Künstler erschienen war, dann wird hier eher nicht die eigene Position befragt. Da drängen dann Ottingers heutige wie vergangene Bildern aus heutiger Sicht doch nach Rahmung und Aktualisierung – vielleicht nach einer Positionierung der älteren Künstlerin zu dem, was sie da filmt oder gefilmt hat, vielleicht auch mal nach einer Distanzierung zum jüngeren Ich. So vielschichtig Paris Calligrammes die Überlagerungen von Gesellschaft, Kunst und biografischer Entwicklungsgeschichte eigentlich zeigt, so sehr bleibt der Film mitunter in der verträumten Deckungsgleichheit der beiden Ottingers stecken.
Der Film steht bis zum 06.07.2022 in der 3Sat-Mediathek.
Neue Kritiken

Winter in Sokcho

Die Spalte

Hamnet

Die Stimme von Hind Rajab
Trailer zu „Paris Calligrammes“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (10 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.











