Pandoras Vermächtnis – Kritik
Ein Dinosaurier der deutschen Filmgeschichte – und die Spuren, die er in der Gegenwart hinterlassen hat. Angela Christliebs Pandoras Vermächtnis wirft einen aufregenden, erhellenden Blick auf G.W. Pabsts Leben und Werk.
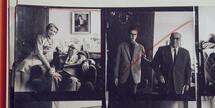
Wie rückt man einen Dinosaurier an seinen Platz? Für Ben Pabst ist das eine sehr konkrete Frage, als er 2020 im Zürcher Zoologischen Museum das zusammengefügte Skelett eines Plateosauriers in eine Fensternische schiebt. Gleichzeitig ist es die Frage der Regisseurin Angela Christlieb in diesem Film: wie sich dem Regisseur Georg Wilhelm Pabst annähern, der, ähnlich wie Friedrich Wilhelm Murnau und Fritz Lang, zu einem regelrechten „Dinosaurier“ der deutschen Filmgeschichte erklärt worden ist? Überlebensgroß, tyrannisch und genial, über Zweifel erhaben, definitiver Begründer eines deutschen filmischen Realismus. Doch in beiden Fällen gilt: Vor dem Zurechtrücken muss man den Dinosaurier zusammensetzen.
Christlieb stellt die (Re-)Konstruktion, die das Erinnern ausmacht, ins Zentrum. Vier Protagonisten hat der Film, und alle sind sie nicht G.W. Pabst (im Familienkreis heißt er bis heute nur „der GeWeh“). Aus der Vergangenheit spricht seine Ehefrau Trude Pabst durch Briefe und Tagebücher, in der Gegenwart die drei Enkel Ben, Daniel und Marion. Anhand von Fotoalben, Filmen, Gesprächen und Erinnerungen entsteht ein Bild – mehr Spinnwebe als Mosaik - nicht nur des großen Regisseurs, sondern auch seines verworrenen Fortbestehens in Ehefrau, Kindern und Enkeln. Rückwirkend werden schließlich auch Pabsts Filme zu einem Teil dieses Bildes.
Familienfilmgeschichte
Ben Pabst ist benannt nach dem Helden des Films „Geheimnisvolle Tiefe“ seines Großvaters G.W. Der Benn des Films ist ein prähistorischer Archäologe, der Gegenwarts-Ben ist Paläontologe geworden. Lustig, nicht?

Solcherart und doch um einiges komplexer sind die Querverbindungen, die Christlieb aufspannt, zwischen den sehr heutigen Nachkommen und den Pabst-Filmen der 1920er bis 1950er Jahre. Der Filmarchäologe Benn verweist nicht nur auf den Enkel, sondern in seiner die eigene Verlobte vor den Kopf stoßenden Arbeitsbesessenheit auch auf die vom Regieberuf gebeutelte Ehe von G.W. und Trude. Seine Frau hat der Regisseur des öfteren von sich ferngehalten, wenn es hieß, einen Film zu drehen. Dieser Beziehung, die sich um verzweifelte Sehnsucht und entnervte, herrische Väterlichkeit dreht, spürt der Film in G.W.s Werk besonders produktiv nach. Vor allem dann, wenn er intime Schilderungen aus Trudes spiritistisch geprägtem Traumtagebuch in G.W.s Filmen bis ins Detail abgebildet zu finden vermag.
Bemerkenswert ist dabei auch, dass G.W. gerade für seine Inszenierung freier, neusachlicher und misshandelter Frauen bekannt wurde – in Filmtiteln wie „Die Büchse der Pandora“ oder „Die Herrin von Atlantis“ klingt das Emanzipatorische mit einer verhängnisvollen Note an – und selbst viel dafür tat, um seine Trude kleiner zu halten, als sie es gern gewesen wäre. Nicht, dass man darüber erstaunt sein müsste, dass Werk und Autor nicht ineinander aufgehen; aber auf diese Weise erzählt der Film auch von der Geschichte, die hätte sein können: Trude Hennings, geborene Pabst, als Schauspielerin, Modehausinhaberin, noch häufiger Mutter.
Der Boden der Tatsachen

Die Vergangenheit ist für diesen Film kein Brunnen, aus dem man nur das Wasser objektiver Wahrheiten und Lebensdaten zu schöpfen braucht. Vielmehr ist sie ein Geflecht, das von der Gegenwart aus gesponnen wird. Sie ist spekulativ, unabgeschlossen, bruchstückhaft, medial vermittelt, subjektiv, geheimnisvoll. Start- und Endbild des Films ist die Fahrt durch endlosen Weltraum, fernab des sichernden Boden der Tatsachen.
Weite Strecken über begleiten wir die Enkelkinder dabei, wie sie in den Archiven ihren Eltern und Großeltern begegnen. Materialität ist dabei von Belang: Fotos verblassen, Tonbänder knacken, Magnetbandfilme brechen irgendwann ab. Was überliefert ist und was uns Zugang bieten soll zur Vergangenheit, ist gebunden an eine archivarische Praxis. In gemeinsamen, intimen Gesprächen horchen die Enkel dorthin, wo Trude und G.W. noch in die Gegenwart wirken. Hier wird jedoch gleichzeitig deutlich, dass, so sehr man sich auch zur Selbstanalyse nötigt, kein Abschluss, nichts Definitives, keine Erlösung sich einstellt. Vielmehr stehen wir dem Historischen, wenn wir ehrlich sind, hilflos gegenüber.
Die Komplexität alles Historischen
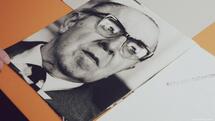
Gerade darin gelangt in „Pandoras Vermächtnis“ die Gegenwart zur Geltung. Wir sehen Marion Jaros, die Enkelin, wie sie, in Wien und bei Nacht, Wiener Nachtpfauenaugen fängt. Sie klärt uns über die sexuelle Rohheit dieser Schmetterlinge auf, in ihrem Insektenkäfig warten drei Weibchen darauf, dass ihre Düfte ein Männchen anlocken. Schnitt auf Greta Garbo, die in „Die freudlose Gasse“ (1925) vor einem dreigeteilten Spiegelschrank sitzt. Ein wollüstiger Mann tritt ein, im Spiegel kreist er Garbo in dreifacher Gestalt ein. Visuell entfalten diese nichtintuitiven Montagen einen Reichtum und eine Dichte, die das Wunderbare an “Pandoras Vermächtnis“ ausmacht. An Ende wissen wir nicht mehr über den großen Regisseur, aber wir ahnen etwas von der Komplexität und Unverfügbarkeit, die alles Historische ausmacht.
Der Historiker Achim Landwehr hat in seinem Essay über die „anwesende Abwesenheit der Vergangenheit“ die Vermutung aufgestellt, dass es am ehesten Filmen gelingen kann, der ungreifbaren Dynamik von Pluralität, Gleichzeitigkeit und Verschränktheit unterschiedlicher Zeiten gerecht zu werden – „Pandoras Vermächtnis“ leistet ebendies und eröffnet einen ungewissen, aber redlichen Zugang zum Historischen.
Neue Kritiken

Send Help

Little Trouble Girls

White Snail

Winter in Sokcho
Trailer zu „Pandoras Vermächtnis“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (6 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.










