Pain, Vengeance? – Kritik
Performative Wiedervorlage: Stefan Hayns Pain, Vengeance?, der am Mittwoch im Berliner Arsenal zu sehen ist, besucht mit zwei Texten des Shoah-Überlebenden Robert Antelme deutsche Gedenkstätten – und begibt sich auf dessen Suche nach einer neuen Gesellschaft und einer neuen inneren Welt.
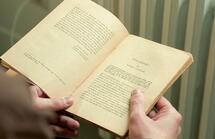
Ein Tod kann nicht mit einem anderen Tod aufgewogen werden, heißt es in dem ersten der beiden Texte, entlang derer dieser Film sich ausrichtet. Sondern nur durch die Entstehung einer neuen Gesellschaft und einer bestimmten Form der inneren Welt. Der Tod, der nicht aufgewogen werden kann, ist der Tod im Lager. Autor des Textes mit dem Titel „Vengeance?“ ist der Franzose Robert Antelme, verfasst hat er ihn im November 1945 in noch frischer Erinnerung an seine Inhaftierung in den deutschen Konzentrationslagern Buchenwald, Bad Gandersheim und Dachau. Der andere Tod, gegen den er anschreibt, der Tod, der den ersten nicht aufwiegen kann, wäre der Tod der Blutrache, der Tod der Vergeltung, der etwa an deutschen Kriegsgefangenen vollstreckt werden könnte, und sei es nur aus Nachlässigkeit, indem die Bedürfnisse der Inhaftierten nicht ausreichend berücksichtigt würden. Dieser Tod wäre, das ist die Überzeugung, die aus dem Text spricht, eine Schande. Nicht etwa, weil er genauso schlimm wäre wie der erste Tod. Ganz im Gegenteil: Dieser erste Tod, der Tod im Lager, kennt kein Äquivalent. Eben deshalb steht es den Überlebenden nicht an, in seinem Namen selbst zu Mördern zu werden. Sie würden damit die Erfahrungen, die sie gemacht haben, entehren.
Die materielle Basis des Erinnerns

Was aber hat es mit der neuen Gesellschaft und der inneren Welt auf sich, auf die sich Antelmes Hoffnung stattdessen richtet? Woran wird man sie erkennen, wenn sie eintritt? Oder leben wir etwa schon in ihr? Denn immerhin: So unperfekt unsere Welt auch sein mag, eine zweite Shoah hat sie nicht mehr hervorgebracht. Aber ist das genug? Stefan Hayns Film Pain, Vengeance? behauptet nicht, solche Fragen beantworten zu können. Hayn filmt weder die neue Gesellschaft und die innere Welt, von der Antelme spricht, noch filmt er beider Unmöglichkeit. Was er jedoch filmt, sind Orte, an denen an der neuen Gesellschaft und der inneren Welt gearbeitet wird. Mit offenem Ausgang.
Wenn Antelmes Utopie einer neuen Gesellschaft und einer inneren Welt irgendwo greifbar wird, dann, das ist die unmittelbar schlüssige Intuition des Films, auf Erinnerungsstätten an die Geschichte der Shoah und des Zweiten Weltkriegs. Hier verbindet sich idealerweise beides: ein physisch existenter, von gesellschaftlichen Kräften – im besten Fall: von einem wie auch immer minimalen Konsens – in Beschlag genommener und durchgeformter Raum; und eine Reflexion, deren Ort nur ein innerer sein kann, da sie auf Abwesendes, Vergangenes, Totes verweist. Selbstverständlich führt das erste nicht zwingend zum zweiten. Ein Umstand, der wieder und wieder öffentlich diskutiert wird, zuletzt etwa unter Stichworten wie „Versöhnungstheater“. Ebenso selbstverständlich sollte jedoch sein, dass gesellschaftliches Erinnern nicht ohne eine materielle Basis auskommt, unter anderem eben in Form von Gedenkstätten.
Keine wasserdichten Argumente

Stefan Hayn hat für seinen Film Gedenkstätten aufgesucht. Die in Dachau, auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers, und andere. Die meisten, aber nicht alle, gedenken deutschen Verbrechen aus der Zeit der Naziherrschaft. Es sind Orte unserer Gegenwart, Orte, an denen sich eine Gesellschaft der Gegenwart zu sich selbst verhält. Ein Schüler liest einen selbstverfassten Text vor, der sich in Antelmes Perspektive hineinzuversetzen versucht. Ein anderer Schüler liest ebenfalls einen selbstverfassten Text vor: „Lass mich in Ruh’. Ich möchte leben, mit meiner Sitte, meinen Gebräuchen, meinem Glauben, mit meiner dunklen Hautfarbe, mit meinen dunklen Augen (...) als Mensch, wie Du und Du und Du. Lass mich in Ruh’.“ Auf einem Plakat vor einer historischen Fotografie wird für die DeutschlandCard geworben: „Hätte, hätte DeutschlandCard… hätt’ ich heute nichts bezahlt.“ Ein bayerischer Kultusminister hält eine Rede über Vergangenheitsbewältigung, in der, wie Hayn im Gespräch mit Bert Rebhandl ausführt, „ein problematisches ‚Wir‘ und ‚Nie Wieder‘ beschworen wird.“
Es geht Hayn jedoch nicht darum, unterschiedliche Modi des Gedenkens oder auch Nichtgedenkens zu katalogisieren, bewertend zu sortieren, gegeneinander auszuspielen. Stattdessen ergänzt er diese Modi durch eine Relektüre, eine performative Wiedervorlage zweier Texte Antelmes. Den eingangs erwähnten „Vengeance“, in dem der Autor sich gegen jede Vergeltung ausspricht, gegen den Impuls, Gewalt mit Gewalt beantworten zu wollen, liest ein französischer junger Mann. Das Gesicht oft von der Kamera abgewandt, spricht er Antelmes Sätze nicht zu uns, sondern in erster Linie zu sich selbst. Man kann kaum anders, als an die Filme Jean-Marie Straubs und Danielle Huillets zu denken, die für Hayns Arbeit stets eine zentrale Referenz sind: Wir sind in der Gegenwart des Textes, aber die Distanz zur Vergangenheit, zu Zeit, Ort und Umständen seiner Entstehung, bleibt gewahrt.
Antelmes Aufruf zur Versöhnung, das sei hinzugefügt, ist historisch nicht unwidersprochen geblieben, und er bleibt es auch im Film nicht. Verlesen wird, im selben Duktus wie die Antelme-Lektüren, ein Einwurf des Literaturkritikers Charles Eubé, der unter anderem auf die Anspruchshaltung vieler Deutscher verweist, die fordern, ihnen müsse sofort und umfassend vergeben werden. Kein Zweifel, dass Hayn sich der Position Antelmes näher fühlt. Diese enthält freilich, das ist eine ihrer Stärken, gemäß ihrer inneren Logik die Möglichkeit des Widerspruchs. Sich einer absoluten, abschließenden Antwort wie der Blutrache zu verweigern, heißt einzugestehen, dass jede Antwort, inklusive der eigenen, sich als falsch erweisen kann. Auch der Film ist keineswegs daran interessiert, sein eigenes Argument „wasserdicht“ zu machen, was sich unter anderem darin niederschlägt, dass er „Vengeance?“ einen zweiten, deutlich schwerer zu deutenden Text zur Seite stellt.
Bewältigen oder Vorankommen?

Ganz anders als die erste funktioniert diese zweite Lektüre, die sich einer Passage aus Antelmes bekanntestem Werk, dem 1947 erschienenen Erinnerungsbuch L’espèce humaine widmet. Sie behandelt eine Auseinandersetzung unter Gefangenen eines Lagers, die damit beginnt, dass einem Häftling Brot gestohlen wird. Die Umstände lassen keinen Zweifel daran, dass der Täter ein Mithäftling ist. Antelmes Text stellt dar, wie die Welt der Gefangenen in Folge dieses Vorfalls (noch weiter) zusammenschrumpft. Weil die Wiederholung des Diebstahls die ohnehin schon prekäre Lebensgrundlage der Gefangenen endgültig zerstören würde, muss er unbedingt verhindert werden. Daraus folgt: Der Brotdieb kann als nichts anderes denn als ein Brotdieb angesehen werden. Nach seinen Gründen etwa ist nicht zu fragen. Es ist dieser in gewisser Weise absolute Moralbegriff, der die Wirklichkeit des Lagers von jeder anderen Wirklichkeit trennt. Sobald die Welt, also der Platz, von dem aus man spricht, kein Lager mehr ist, ist ein Brotdieb immer schon mehr als ein Brotdieb. Wie man mit ihm, und auch mit der historischen Schuld, umgehen soll, ist damit freilich noch nicht gesagt.
Diesen zweiten Text adaptiert Hayn in Form einer szenischen Lesung; das heißt, sie wird mit verteilten Rollen gesprochen, und zwar in der Brunshausener Kirche bei Bad Gandersheim, die 1944 als Auffanglager für Deportierte diente. Schon das abstrakt und seltsam hybrid anmutende Setting – einer steht vor Gedenktafeln im Stil aktueller Museumsdiktion, ein anderer liegt unter einer Bank, umgeben von Stroh – verhindert, dass die Sprecher zu Wiedergängern der Häftlinge werden. Die Frage, inwieweit es sich um Darsteller handelt, stellt sich dennoch. Einige von ihnen sind mehr, andere weniger kostümiert, gelegentlich springt nicht nur die lautliche Substanz des Textes, sondern auch der vermittelte Inhalt auf die Körper der Sprechenden über, etwa wenn einer die Suchbewegung eines Gefangenen, der nicht glauben kann, dass ihm die Brotration gestohlen wurde, gestisch nachahmt. Etwas Hilfloses, Tastendes haben diese Bewegungen: Imitationen, die um die kategorische Abwesenheit des Imitierten wissen. Handelt es sich um eine Konzession an eine Form von Illusionismus, die nie ganz zu trennen ist von den Bemühungen, Vergangenheit zu verdinglichen, beziehungsweise zu „bewältigen“? Oder vielleicht doch: um den Versuch, auf dem ewig unabgeschlossenen Weg in Richtung einer neuen Gesellschaft und einer zugehörigen inneren Welt ein paar Schritte vorwärts zu kommen?
Am Mittwoch, den 06.09.2023 läuft der Film im Berliner Kino Arsenal.
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Bilder zu „Pain, Vengeance?“




zur Galerie (4 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.







