Our House – Kritik
Von erzwungenen Bewegungen und notwendigen Gegen-Bewegungen: Aus der Rekonstruktion eines Gerichtsfalls um sein Elternhaus webt Souleymane Cissé einen filmischen Essay, der der glorreichen Vergangenheit und ungewissen Zukunft seines Heimatlandes gewidmet ist.
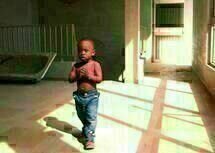
Für ein Film über ein Haus, über den Wunsch zu bleiben, ist Our House (O Ka) von ziemlich viel Bewegung durchzogen. Da ist der Wind, der in den Bildern von damals, von heute, vielleicht auch in denen aus der Zukunft, den westafrikanischen Sand bewegt; da sind die Ameisen, die dessen Körner verschleppen; da sind die Strauße, die weglaufen, vor irgendetwas; da sind die Kinder, die sich und nur sich bewegen, getrieben von der Neugier aufs Leben. Souleymane Cissé erinnert sich, dass seine Mutter einst erzählte, er sei bereits mit zehn Monaten aufgestanden und losgelaufen, sodass ihr irgendwann nichts übrig blieb, als den Sohn auf ihren Rücken zu binden.
Erinnernd zurück, hoffend nach vorn schauen

Das Bild eines Kindes, von nur kurzer Dauer, es suchte bereits Cissés Die Zeit des Windes (Finye, 1982) heim, ein Werk, das als Übergang gilt zwischen dem frühen engagierten Realismus des Regisseurs und seinen eher fantastischen Filmen wie Yeelen (1987, siehe auch unser Interview mit Cissé). Hier nun, im essayistischen Our House, bewegen sich erneut Kinder durch überbelichtete Videobilder, wieder ist ihre Präsenz zugleich konkret und abstrakt. Sie binden das Ereignis aus der Gegenwart, um das dieser Film kreist, an Vergangenheit und Zukunft.
Die Erinnerung an die eigene Kindheit und die Hoffnung auf zukünftige Kindheiten ohne Barbarei, in einem freien Mali – beides bindet Cissé an einen Rechtsstreit um sein Elternhaus, in den vor allem seine vier Schwestern verwickelt sind. Es geht um sich widersprechende Dokumente: eines aus dem Jahr 1920, das die Familie Cissé als rechtmäßige Besitzer des Hauses ausmacht, eines aus dem Jahr 1949, das die Familie Diakité als Zertifikat für den eigenen Anspruch auf eben dieses Haus vorbringt. Vor einigen Jahren gab ein bestochener Richter den Diakités recht, Souleymanes Schwestern wurden auf die Straße gesetzt, noch immer läuft das Verfahren – das oberste Gericht hat das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Unser Haus, unser Land

Narrative Elemente dieses Rechtsstreits wie das Telefonat, in dem er von der Entscheidung erfährt, oder die Räumung des Hauses hat Cissé mit Schauspielern (und seinen Schwestern) reinszeniert, sein Film ist keinem engen Begriff des Dokumentarischen verpflichtet, ist eher eine kluge, extrem heterogene Montage aus Archivaufnahmen (etwa von den Dreharbeiten zu Yeelen), Impressionen aus der zur Hauptstadt Bamako gehörenden Gemeinde Bozola, den erwähnten fiktionalen Elementen sowie Voice-over-Monologen und Gesprächen mit den Schwestern, die ihr Lager in der Nähe des Hauses aufgeschlagen haben, um gegen die Ungerechtigkeit zu protestieren. Was sie sagen, ist Klagelied und Kampfansage zugleich. Sie wollen bleiben. „Und wenn wir sterben müssen.“
Souleymane hört nur zu. Die Opferbereitschaft seiner Schwestern scheint er weniger als angemessene Reaktion im konkreten Fall zu bewundern – viel lieber wäre es ihm, sie würden in ein von ihm renoviertes neues Haus ziehen – denn als notwendig gewordene politische Haltung im Mali der Gegenwart. Als nationale Allegorie ist Our House von Beginn an lesbar, wenn diese Ebene auch erst im letzten Teil explizit wird. Für Cissé ist die unrechtmäßige Räumung des Hauses Beispiel für eine gescheiterte Vorstellung von Gerechtigkeit, die das von Islamisten bedrohte Land zusätzlich von innen heraus schwächt. Das Haus der Cissés, deren Familie auf eine jahrhundertealte Tradition zurückblickt, steht zugleich für das ganze Land, das von Norden her geräumt, gesäubert werden soll.
Für die widerständige Bewegung
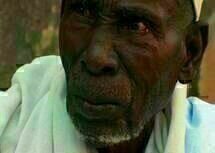
Manchmal schwingen hier für fremde Ohren nicht unproblematische nationalistische Untertöne mit; da heißt es etwa, den Amerikanern sei es gelungen, nach dem 11. September ihre Einheit zu bewahren, was nun auch das Ziel Malis sein müsse. Aber klar: Was in den USA ein Terrortag war, ist in Mali noch immer Status quo; es ist kein punktuell angegriffenes, sondern ein flächenhaft besetztes Land. In den Bildern geht es dann aber nicht um Einheit, sondern um Widerstand. Immer widersetzt sich etwas: die vier Schwestern ihrer Umsiedlung, die Naturbilder ihren Bedeutungen, die Schulkinder den Disziplinierungen ihrer Lehrer. Und am Punkt der höchsten fiktionalen Dichte schmeißt eine Polizistin während der Räumung des Hauses ihre Uniform weg und verweigert der Macht ihre Gefolgschaft.
„Mali ist nicht unveränderlich“, sagt Cissé einmal, wie um zu unterstreichen, dass es ihm um das bloße Bewahren nicht geht, wenn er sein geräumtes Haus, wenn er die zerstörten Schätze Timbuktus betrauert. Sein Plädoyer für die „Wahrheit“, für eine Zukunft der Kinder, mag manchmal schlicht daherkommen, doch die melancholische Sicht auf Vergangenes, die pathetische Hoffnung auf eine bessere Zukunft sucht nicht nach Mitleid, sondern versteht sich als Intervention und als Aufruf zum Handeln. Deshalb durchzieht Bewegung diesen Film, und deshalb sind die Kinder dieses Films weniger statische Symbole der Unschuld als Subjekte der suchenden, neugierigen, widerständigen Bewegung.
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Bilder zu „Our House“




zur Galerie (5 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.








