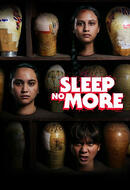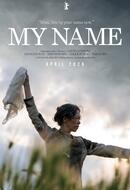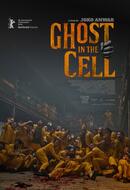Museum of the Revolution – Kritik
Der sozialistische Prachtbau, der diesem Dokumentarfilm seinen Namen gibt, wurde nie fertiggestellt; einen Keller aber gibt es, der die beherbergt, die in der Gesellschaft keinen Platz haben. Museum of the Revolution folgt ihren Bewegungen durch die serbische Hauptstadt.

Für 20 Dinar gibt es Kaugummis, für 80 Dinar Chips. Milica hat sich informiert und kann die Preise der begehrten Snacks auswendig aufsagen. Die Naschereien sind die Motivation des jungen Mädchens, wenn sie an den Kreuzungen Belgrads auf das Rot der Ampelschaltungen wartet, um zusammen mit Mutter Vera Autoscheiben zu putzen. Nicht selten werden die beiden weggeschickt. Aber Milica hat nun mal ein Ziel, und dieses Ziel heißt heute Chips. Da gibt es keine Wahl, da muss angehalten und geschrubbt werden.
Wo das Licht nicht hinfällt

Von Hoffnungen handelt der Dokumentarfilm von Srdjan Keca, von den kleinen, die zwischen den frittierten Kartoffelscheiben in einer Tüte warten, und den großen, die weniger in greifbarer Nähe liegen. Museum of the Revolution heißt er und erzählt vom Licht, indem er mithilfe von Licht erzählt. Seinen Ausgangspunkt nimmt er dort, wo die Helligkeit fehlt und Milica wohnt. Denn der sozialistische Prachtbau, der dem Film seinen Namen leiht und 1961 von Vjenceslav Richter entworfen wurde, wurde nach Titos Tod nie fertiggestellt; einen Keller aber gibt es, in dem die Tochter und die Mutter mit weiteren Bewohner*innen leben, allen voran mit der älteren Mara, die schon seit einer Weile dort ist, öfter mit Milica Karten zockt oder für die Puppe des Mädchens Kleidung strickt.
Wie sie alle in diese Situation gekommen sind, davon berichten weder sie noch der Film en detail. Es gibt Hinweise, und doch lässt Museum of the Revolution den drei Frauen ihre Geschichten in diesem wortkargen Milieu, lässt sie rätselhaft bleiben, wenn wir ihren Bewegungen durch die serbische Hauptstadt folgen, vorbei an den beleuchteten Häusern, deren Mieten sie sich nicht leisten können, und den Konzerten mit Projektionsshow, zu denen sie nicht eingeladen werden. Immer wieder kehrt die Kamera mit ihnen in die Schummrigkeit der Ruine zurück, ein Ort, der viele kleine Orte versammelt, an denen sich unablässig Trümmer auf Trümmer häufen, es gleichzeitig stauben und tropfen kann. Nicht die Sprache steht bei Keca im Vordergrund, sondern eine bestimmte Atmosphäre, die Materialität einer spätkapitalistischen Gesellschaft, deren Fundament einsturzgefährdet ist.
Die Lust auf das Metaphorische

Gemäß dem Architekten Richter sollte das Museum „die Wahrheit über das jugoslawische Volk“ bewahren – und in gewisser Weise kommt der Keller diesem Auftrag nach, wie Kecas Film herausstellt, wenn er diejenigen beherbergt, die inmitten der Gesellschaft keinen Platz haben, aber ebenda freundschaftlichen und generationenübergreifenden Zusammenhalt praktizieren. Romantisierung wäre trotzdem ein Begriff, der im Hinblick auf den Film diskutiert werden kann, ihn aber eben nicht fasst. Denn wie will ein Film nicht metaphorisch aufgeladen sein, der Museum of the Revolution heißt und sich eben jener Überreste annimmt?
Wie könnte er sich freimachen von jeglicher Deutung, die im Blick auf die unscheinbarsten Szenen steckt? Und wie lässt es sich von einer Kindheit in Armut erzählen, in der eben die Lust auf Süßigkeiten ein universelles Gefühl vermittelt und Anschlussfähigkeiten herstellt, ohne dass dabei naiver Kitsch herauskommt? Vielleicht ist es das, was den Film so interessant macht: dass er sich auf unterschiedlichen Ebenen für Vorgänge des Verfallens und des Vorübergehens interessiert und sie weniger in Beziehung setzt als es vielmehr den Zuschauenden überlässt, was sich aus ihren Fragmenten an Bedeutung zusammenbauen lässt.
Das Heute konservieren

Die Jahreszeiten kommen und gehen in diesem Film. Wo gerade noch Schnee war, liegen nun zwei Freundinnen singend am See. Bald soll über dem Keller ein Konzertsaal als Treffpunkt für die Bürger*innen gebaut werden, bald wird Mara sterben, und bald wird Milica zur Schule gehen. Ihr Vater, der ausschließlich per Telefon in Erscheinung tritt, soll demnächst aus dem Gefängnis entlassen werden. „Die Zeit ist also ein Heute, von vor hundert Jahren bis jetzt“, schrieb Sasha Marianna Salzmann in dem Roman Außer sich (2017) und gibt damit doch eine schöne Zeitangabe, um diesen Film beschreibbar zu machen, der um das Gestern und das Morgen weiß, aber eben solch ein Heute feiert und konserviert, das zu Staub zerfällt, wenn es greifbar, benennbar wird.
„Wo du hingehst, gehe ich auch hin“, verspricht die Tochter der Mutter, ehe vielleicht der Wind kommen und diesen Plan forttragen wird. Aber noch ist nicht die Zeit, noch ist nicht die Stunde. Noch sind wir an dem unmöglichen Ort, der sich „Heute“ nennt.
Neue Kritiken

Ella McCay

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo

No Other Choice

Ungeduld des Herzens
Trailer zu „Museum of the Revolution“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (6 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.