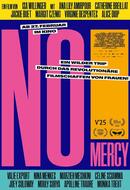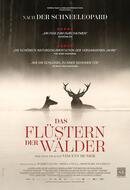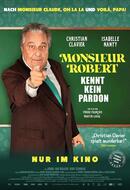Die Maske – Kritik
Eine polnische Dorfgemeinschaft baut sich eine Jesusstatue, und Małgorzata Szumowskas satirischer Blick aufs Geschehen bleibt reichlich zerstreut. Mithilfe von Elektropop gelingt Die Maske dann aber doch noch ein mitreißendes Gegenbild.

Kein Mensch braucht eine über dreißig Meter hohe Jesusstatue, vor allem keine, die als monströser Einzelbau inmitten einer von sanften Hügeln geprägten polnischen Landschaft steht. Eine solche Statue erfüllt keinerlei liturgischen oder rituellen Zweck, wie etwa eine Kapelle oder ein Denkmal mit Heiligenbild, ihr Sinn besteht einzig und allein in einer Monumentalität, die jedes menschliche Maß übersteigt. Eben darum aber hat sich in Małgorzata Szumowskas Die Maske die Bevölkerung einer kleinen polnischen Stadt dazu entschlossen, den Bau einer derartigen Statue in Angriff zu nehmen. Das ganze Land, eigentlich die ganze Welt soll sehen, mit welchem Enthusiasmus sich die Menschen hier die eigene Naturumgebung verschandeln, wie viel Arbeit und wie viel mühsam zusammengespartes Geld sie für eine offenkundige Unsinnigkeit verbrennen, wie beharrlich sie jedem menschlichen Schönheitssinn und jedem menschlichen Bedürfnis zuwiderhandeln – nur um ihren Landstrich mit brachialer visueller Gewalt für das Christentum in Besitz zu nehmen.
Jacek ist als Arbeiter an dem Bau dieser Monumentalstatue beteiligt, obwohl er mit dem kalten und monolithischen Katholizismus, den sie zum Ausdruck bringen soll, kaum etwas anfangen kann. Er lebt als dezenter Außenseiter innerhalb der Dorfgemeinschaft, hört Metal, lässt sich die Haare lang wachsen und brettert mit seinem Auto hemmungslos über die Dorf- und Landstraßen. Dennoch bemächtigt sich die Statue irgendwann auch seines Schicksals: Bei einem Bauunfall verletzt Jacek sich so schwer, dass eine medizinisch revolutionäre Gesichtstransplantation notwendig ist. So kommt er nach langem Krankenhausaufenthalt mit fremdem Antlitz wieder nach Hause – und muss seinen Platz innerhalb der Dorfgemeinschaft aufs Neue ausloten.
Ein zerstreutes satirisches Dauerfeuer
Die Maske zeigt also zunächst ein bestimmtes, eng umgrenztes soziales Gefüge und fügt diesem dann eine tiefgreifende Erschütterung zu, in der Hoffnung, dadurch bislang verborgene Strukturen, Gefühlslagen und Machtverhältnisse zum Vorschein kommen zu lassen. Doch der satirische Blick, den Małgorzata Szumowska vermittels dieser kleinen Dorfgemeinde auf die gesamte polnische Gesellschaft wirft, ist zu unkonzentriert, um inhaltliche Schärfe oder auch nur eine Atmosphäre der ironischen Überdrehtheit entstehen zu lassen. Immer wieder werden einzelne Gesellschaftsbereiche ins Visier genommen, seien es die Kirche, das Fernsehen oder die Konsumkultur, doch bauen diese Szenen nie wirklich aufeinander auf oder werden durch thematische Gemeinsamkeiten miteinander verknüpft. Sie bleiben bloße Einzelimpressionen, die zudem, gerade weil sie ganz auf sich allein gestellt sind, manchmal wie bloße Abziehbilder altbekannter Karikaturen wirken. So fragt ein Priester etwa während der Beichte lüstern nach allerlei schlüpfrigen Details, so stürzt sich eine Meute erwachsener Menschen während eines Sonderverkaufs halbnackt auf einen Stapel aus Fernsehern, und so will ein Kosmetikhersteller mit Jaceks entstelltem Gesicht eine Gesichtssalbe bewerben. Auch wenn manche dieser Szenen visuell durchaus interessante und unerwartete Wendungen nehmen, verhindert doch die zerstreute Struktur des Films, dass in ihnen irgendwelche größeren kulturellen oder politischen Zusammenhänge erkennbar werden.
Auch als Schilderung eines individuellen Schicksals ist der Film zu unentschlossen: Die Maske widmet sich zwar zum Beispiel ausführlich Jaceks Bemühungen, nach seiner Entstellung die Beziehung zu seiner Verlobten zu retten, scheint sich dann aber für Jaceks Verhältnis zu seinem neuen Äußeren, für die Anpassungen, die er in seinem Selbstbild vornehmen muss, nicht weiter zu interessieren. Der Blick auf das Individuum und der Blick auf die Gesellschaft, sie verschränken sich in Szumowskas Film nicht auf interessante Weise oder geraten in produktive Spannung, sie lenken vielmehr voneinander ab.
Der Elektropop als Erlösungsvision
Die Wirkung von Die Maske beschränkt sich im Wesentlichen auf ein paar wenige Szenen, die dann aber doch sehr mitreißend sind und in denen in der Regel Gigi D’Agostinos „L’amour toujours“ zu hören ist – ein Lied, das den Film wie eine Art Liebesthema durchzieht und in unterschiedlichen Orchestrierungen immer wiederkehrt. So lässt der Film etwa Jacek mit seiner späteren Verlobten zu den stampfenden, von synthetischen Trompeten begleiteten Elektroklängen D’Agostinos auf einem wilden Pferd durch die Abenddämmerung reiten – und erschafft so eine Art Gegenbild zu der starren, freudlosen Wuchtigkeit der Jesusstatue. Die symbolische Kraft des monumentalen Bauwerks, an der sich der Film seine gesamte Laufzeit über abarbeitet – sie scheint in Momenten wie diesem plötzlich gebrochen zu sein, als wäre sie vertrieben worden durch die wummernden Klänge einer Musik, der jede Art der geschmackvollen Zurückhaltung fremd ist und die sich nicht um ewige oder gar um göttliche Maßstäbe kümmert.
Neue Kritiken

Marty Supreme

Father Mother Sister Brother

The Day She Returns

Prénoms
Trailer zu „Die Maske“


Trailer ansehen (2)
Bilder




zur Galerie (10 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.