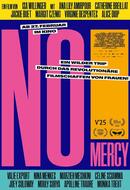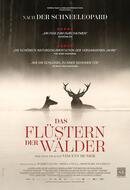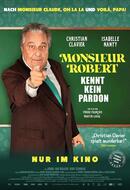Moria Six – Kritik
Jennifer Mallmann nähert sich in ihrem Dokumentarfilm dem Alltag in Moria auf Lesbos nach dem großen Feuer von 2020. Moria Six will alles richtig machen, setzt aber vor allem die eigene Ohnmacht in Szene.

Nicht dass es im Camp Moria auf der griechischen Insel Lesbos im September 2020 brannte, sei die Katastrophe, sondern dass es einen Ort wie diesen, der medial als „Geflüchtetenlager“ beschrieben wird, überhaupt gibt. Eine solche Setzung steht zu Beginn von Jennifer Mallmanns Moria Six, der sich folglich eben nicht einer Aufarbeitung der Geschehnisse widmet, obwohl es über den Rückgriff auf Einblendungen, Nachrichtenbilder, Expert*innen zunächst so wirkt – und obwohl er auch mit jenen sechs jungen Männern zu sprechen versucht, die nur eine Woche nach dem Feuer als Brandstifter festgenommen wurden.
Betroffenheiten
Dass alles nicht so abgelaufen sein kann, wie es der Kronzeuge beschrieben hatte, der vor Gericht nie erschien, aber durch seine Falschaussage die Grundlage für die Verurteilungen lieferte, hat das Kollektiv Forensic Architecture im letzten Jahr in einem aufwändigen 24-minütigen Video bewiesen. Dieses investigative Interesse teilt Moria Six nicht, auch wenn hier ebenfalls der Justizskandal thematisiert wird. Stattdessen will Mallmanns Film sich als Geste der Solidarisierung verstanden wissen, gegen das Schweigen anarbeiten, das seither eingekehrt ist und der staatlichen Seite mehr als gelegen kommt, sowas wie Aufmerksamkeit herstellen.
Neue Camps wurden erbaut, die Zäune sind jetzt noch höher, die Zugänge per Fingerabdruckscan reguliert. Anwält*innen, Menschenrechtsbeobachter*innen und Journalist*innen erhalten nur in seltenen Fällen Einlass. Mallmann und ihr Team kommen in eines dieser neuen Lager, dürfen hinein in die Kommandozentrale mit den vielen Überwachungsbildschirmen, die schön breit und glossy sind. Fasziniert ist Kamerafrau Sina Diehl sichtlich von den Architekturen, von den hohen Türmen mit den Kameras, die sie so von unten filmt, dass sie noch eindrucksvoller wirken.
Welche Bedingungen für den Dreh hier ausgehandelt wurden, wird im Film nicht deutlich. „Gerne würde ich die Menschen hier fragen, wie es ist, hier zu leben“, ist Mallmanns Stimme aus dem Off zu hören, „doch das fühlt sich falsch an.“ Genau diese Fragen scheinen in Moria Six zunehmend dann aber doch kein Problem mehr zu sein. Im Film zu hören sind sie zwar kaum, aber die Antworten lassen Rückschlüsse auf sie zu. Nicht nur durch das Voice-over also, mit dem immer wieder Tagebucheinträge der Regisseurin eingespielt werden, sondern auch in dem, wonach sie sich bei den Personen vor Ort erkundigt, inszeniert Moria Six eine spezifische emotionale Haltung zu dem Geschehen.
Betroffenheit ließe sich diese Haltung nennen: Weniger im Sinne einer empowernden Selbstbeschreibung für diejenigen, die in ihrem Alltag verschiedene Diskriminierungen erfahren, mehr als Bewegtheit einer weißen Filmemacherin, die sich mit den Zusammenhängen konfrontiert sieht, von denen sie gesellschaftlich profitiert. Die Bestürzung, die Unbeholfenheit, die Überforderung ins Zentrum eines solchen Dokumentarfilms zu stellen, könnte durchaus ein produktiver Ausgangspunkt sein. So sehr sich Moria Six allerdings den Menschen an die Seite stellen will, das Engagement von denjenigen bewundert, die sich einsetzen, setzt er doch vor allem eine Ohnmacht, und zwar seine Ohnmacht in Szene, übernimmt in den Aufnahmen eine Rhetorik der Institutionen, ohne sich zu ihr zu verhalten, und verunklart die Verhältnisse, in deren Mitte er selbst steht – bei gleichzeitiger Geste des Authentischen und Ehrlichen, die im Voice-over steckt.
Die Bilder sind längst da
Wenn die Katastrophe nicht der Brand in Moria ist, sondern die Tatsache, dass es diesen Ort überhaupt gibt, dann gibt es von dieser Katastrophe bereits jede Menge Bilder. Das zeigt nicht zuletzt an einer Stelle eine Aktivistin, die eifrig das Unrecht vor Ort dokumentiert; das zeigen die unzähligen Handyvideos, aus denen die Recherchearbeit von Forensic Architecture besteht; das zeigt die Genauigkeit, mit der verschiedenste Organisationen Beweismittel für internationale Gerichtsprozesse sammeln, die trotz Rechtmäßigkeit abgewiesen werden.
Dass es diese Masse an Bildern gibt, und dass das, was sie zeigen, seit geraumer Zeit eben gar nicht mehr so unvertraut ist, wie es bei Mallmann den Anschein hat, dazu hat Moria Six erstaunlich wenig zu sagen. Dass wir diese Bilder akzeptiert haben, uns vielleicht kurz schämen, wenn wir sie sehen, traurig oder wütend werden, dass wir aber nicht für Veränderung einstehen, und es auch dieser Film nicht schafft, das ist ohne Zweifel nicht minder katastrophal.
Neue Kritiken

Scarlet

Marty Supreme

Father Mother Sister Brother

The Day She Returns
Trailer zu „Moria Six“

Trailer ansehen (1)
Bilder



zur Galerie (3 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.