Menashe – Kritik
Universelle Sackgasse: Ein paar Gedanken anlässlich eines Films, der sich ein bisschen zu leicht charakterisieren lässt.

Gerade beim Festival-Talk zwischen den Kinos, wo man mit Filmtiteln, Filmemachern und Inhaltsangaben schnell durcheinanderkommt, reduziert man ein Werk gerne mal auf ein Thema – „na dieses Inzestdrama“ –, einen großen Namen – „na dieses Huppert-Ding“ – oder eine bestimmte Ästhetik – „na dieses Teil ohne Schnitt“. Die Regel geht natürlich nicht immer auf, aber häufig sind solche Filme am interessantesten, die sich am schwierigsten verschlagworten lassen. Menashe von Joshua Z. Weinstein ist da leider keine Ausnahme. Der Film läuft im Forum und lässt sich schnell charakterisieren, spielt er doch in einer vom Kino selten in den Blick genommenen jüdisch-orthodoxen Gemeinde Brooklyns und wurde fast komplett auf Jiddisch gedreht. Regisseur Weinstein war es ein Anliegen, innerhalb dieses Settings eine „universale Geschichte“ zu erzählen, um damit Distanzen zu überbrücken und dem Blick aufs Fremde etwas entgegenzusetzen. Aber kann das gelingen?
Wir lernen also den titelgebenden Menashe (Menashe Lustig) kennen, der nach dem Tod seiner Frau um das Sorgerecht für seinen Sohn Rieven kämpft. Menashe ist in Dingen der Religion durchaus ein gemäßigter Rebell, trägt selbst zu wichtigen Anlässen keinen Hut, will sich nicht sofort wieder binden, sondern sucht nach einer Frau, die zu ihm passt. Schnell sind die Dinge also etabliert: ein Held, ein Konflikt und zum x-ten Mal Tradition vs. Moderne. Weinstein hat Menashe mit Laiendarstellern aus Borough Park gedreht, und auch das trägt zu der eigentümlichen Dynamik aus universalen Themen und konkretem Milieu bei, die Weinsteins hehres Anliegen wieder untergräbt. Denn je universaler der Film, desto eher schieben sich eben doch wieder jene kulturellen Spezifika in den Vordergrund, die man gerade im Universellen zu versenken versucht.

Über die „Gefahr einer einzigen Geschichte“ hat die nigerianische Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie kürzlich referier, über den Gewaltakt, eine Person oder ein Land oder sonst etwas mit einer einzigen Geschichte zu beschreiben, wo doch eine jede aus unzähligen solcher Geschichten besteht. Das Problem von Filmen wie Menashe scheint zu sein, dass Figuren für sie aus exakt zwei Geschichten bestehen: aus einer universellen, menschlichen und einer identitären, kulturellen. Was uns bleibt nach Abzug der ganzen universellen Themen und Konflikte, das ist dann eben doch nur der interessierte Blick in eine fremde Welt. Menashe ist also beim Festival-Talk zwischen den Kinos „dieser Film mit den Orthodoxen“, „der auf Jiddisch“. Nicht nur, weil er sich so am einfachsten beschreiben lässt, sondern leider auch, weil er sehr viel mehr gar nicht sein will.
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Trailer zu „Menashe“

Trailer ansehen (1)
Bilder
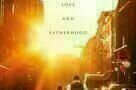


zur Galerie (3 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Moinet
Danke, das hat mir geholfen, mein Verhältnis zu dem Film besser zu verstehen. Ich würde sagen, ja und nein: Dein spannender Gedankengang, den man in der Filmgeschichte sicher von Zeit zu Zeit wieder zu Rate ziehen können wird, vor allem im Arthouse-Mainstream und im Fernsehen, erklärt, warum Figuren und Konflikte mich nicht nachhaltig beschäftigten. Sie wirkten, so sage ich jetzt nach der Lektüre des Textes, irgendwie unentschlossen. Unentschlossenheit vermitteln geht ja aber nur, wenn vorausgearbeitet ist, daß es konkrete Möglichkeiten gibt. Da nennst und begründest du die Begrenzung auf hier exakt zwei. Und dieses Schema lenkt den Blick dann auf Unterkomplexes und ist ärgerlich. Allerdings möchte ich auch etwas dagegenhalten: Mir geht bis hierhin die Sprache dabei zu sehr unter. Meines Wissens nach versteht nicht einmal der Regisseur selbst jiddisch, das scheint also wichtige Bedingung für den Film zu sein, und es ist auch der erste fast ganz jiddischsprachige Film seit über 70 Jahren, wodurch ein nicht zu unterschätzender filmhistorischer Bezug hergestellt ist. Mich hat es gefreut und auch berührt, eine Filmdauer lang in Brooklyn in die Welt dieser Sprache abtauchen zu dürfen. Und das ist zumindest für manch einen Muttersprachler dieses Planeten gleich ein deutlich weniger ethno- oder soziographischer Blick als vielleicht die reine Ebene segregierter orthodoxer Religiosität. Vermutlich zu gewagt, aber das Reproduzieren bekannter Muster – eine nette kleine New-York-Geschichte, die auf expliziter Erzählung aufbaut – öffnet möglicherweise sogar gerade Raum für das Wahrnehmen der Sprache. Und in der Sprache, wenn man sie denn betrachtet nicht aus dem unveränderlichen Sprachkursbuch, sondern als punktuelle Praxis einer historisch-fluide entstandenen Kommunikationsgrundlage mitten in New York City, sind natürlich wahrlich unzählige Geschichten angedeutet. Quasi ein Korrektiv zur einen einzigen Geschichte, hiermit wird die These des Gewaltakts erst bewiesen. Hier überbrückt der Film seinen Dualismus, hier wird digital zu analog. Also klar, Menashe ist "der auf jiddisch", und vielleicht will er sogar gar nicht sehr viel mehr sein, aber Film hat auch schon deutlich weniger zu Tage gefördert.
Till
Ja, das ist ein richtiger und wichtiger Punkt, den ich in dem Text zu zu lapidar abtue. Mir schien da einfach eine gewisse Formelhaftigkeit am Werk, die mir derart bekannt vorkam, dass ich den Schwerpunkt eher auf die Formel gelegt habe als auf die dann vielleicht doch vorhandenen Spezifika – oder eben die Aneignung der Formel als explizite Strategie. Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass ich dem Film außerhalb eines Festivalkontexts auch positiver eingestellt gewesen wäre – so hat er ein bisschen den Frust über "Festivalkino" im allgemeinen abbekommen. Insofern ist gerade der Hinweis auf den Eigenwert der Sprache eine wichtige Korrektur bzw. Ergänzung – danke dafür.









2 Kommentare