Marguerite and Julien – Kritik
My French Film Festival: Inzest auf der Flucht: Valérie Donzelli entfesselt eine Legende aus dem 16. Jahrhundert und fängt sie dann doch wieder ein.

In einer schönen, weil endlich mal nicht nur formal verspielten, sondern inhaltlich ironischen Szene spielen die beiden Geschwister durch, was sie alles wären, würden sie heiraten und Kinder kriegen. Frau und Mann, Mutter und Vater, Onkel und Tante, ihre Kinder wären zugleich Geschwister und Cousins. „C’est gràve“, sagt Marguerite (Anaïs Demoustier) nachdenklich, als ginge ihr auf einmal auf, dass die beiden nicht gänzlich unbegründet von den Mächtigen gejagt werden. Denn Marguerite und Julien (Jérémie Elkaïm) sind längst keine Kinder mehr, wie noch im ersten Teil des Films, sie sind jetzt ein waschechtes couple on the run, ihre Geschwisterliebe kein Kinderspiel, sondern aufrichtig und leidenschaftlich.
Valérie Donzelli hat einen Inzestfilm gedreht, aber auch wenn ein paar Sätze zum Schluss fast nach Plädoyer klingen („Inzest war und wird in Frankreich immer verboten sein“, spricht da ein Richter), geht es ihr darum nicht so richtig. Wenn man es gut meint mit diesem Film, der von einer bedingungslosen Liebe aus dem 16. Jahrhundert erzählt, in dem aber auch Helikopter und Mikrofone vorkommen, dann ist der Inzest für Donzelli eine zeit- und ortlose Fluchtlinie, ein desire on the run, dem sie mit ihrem zunächst ebenfalls fliehenden Film ein Denkmal setzen möchte.
Stilisiertes Märchen

In Das Leben gehört uns (La guerre est déclarée, 2011) hat Donzelli bereits einem vermeintlich ernsten Thema durch ihren anti-sentimentalen Ansatz zu erfrischendem Leben verholfen; verarbeitet hat sie darin die Krebserkrankung ihres Sohnes, aber eben nicht als Rührstück, sondern als beschleunigte Choreografie des Lebens im Ausnahmezustand, reich an Farben und Popmusik. Marguerite and Julien jedoch ist nun nicht aus der Biografie geboren, ist an sich schon ein Märchen, das nach Stilisierung schreit, und vielleicht fühlt sich Donzellis Film deshalb so redundant an. Man lässt sich anfangs noch gern mitnehmen, mitreißen von der Bilderflut, der unaufhörlichen und stets laut aufgedrehten Musik, die zumindest beim furiosen Auftakt weniger untermalt als Bewegung und Montage anleitet.
Leere Freiheit

Donzelli hat Marguerite and Julien also weniger inszeniert als orchestriert, wobei sie zunehmend autoritär in die Symphonie eingreift. Dabei nimmt sie, was sie kriegen kann: Zeitlupen, Jump-Cuts, Kreisblenden, Beethoven, Popsongs, dem konkreten Raum enthobene Close-ups. Und ein paar Mal, da hält das Bild an, da schwenkt die Kamera an den in ihren Bewegungen erstarrten Figuren vorbei, die sich durch ihre plötzliche Stilllegung einer merkwürdigen Plastizität erfreuen. Doch erfüllen derlei Spielereien kaum eine Funktion, die über den Verweis auf filmische Freiheit hinausgingen. Dieses Problem war auch dem Kino der Nouvelle Vague nicht fremd, das hier offensichtlich Pate stand, nicht nur weil der Film auf einem nicht realisierten Drehbuch basiert, das Jean Gruault einst für Truffaut geschrieben hat: Autorenschaft und erzählerische Freiheit erscheinen nicht einfach als Abwesenheit von Zwängen und Konventionen, sondern müssen sich immer wieder aufs Neue im Bild hervorbringen, müssen ihre Distanz zum Konventionellen markieren. Seht her, eine Idee.
Der Unterschied zu den 1960er Jahren besteht nun einerseits darin, dass im Verhältnis zum Vorherigen die spielerische Ästhetik von damals zwar nicht Freiheit als solche, aber eben eine Befreiung darstellte; dass es tatsächlich galt, eine Distanz herzustellen. Heute kennen wir das ja eh alles, die hybride Überlagerung unterschiedlichster Elemente, das Spiel mit den Zeichen. Andererseits richteten sich diese Filme trotz allen Freiheitsdrangs noch immer auf einen Inhalt, und hier wird es mit Marguerite and Julien endgültig problematisch.
Ein Film nimmt seine Figuren fest

Denn Donzellis Film bricht in sich zusammen, wenn er sich auf seinen Inhalt richtet. Es ist bezeichnend, dass die fadesten Szenen solche sind, in denen das Bild tatsächlich nur Marguerite und Julien gehört; wenn sie sich gegenüberstehen, sich endlich haben, sich küssen. Löst sich diese Liebe einmal nicht mehr auf in Farben, in Kostüme, in Musik, in die entfesselte Montage, dann ist da eben auch nichts mehr. Das hat weniger damit zu tun, dass wir die Figuren zuvor kaum kennengelernt haben – es war ja der Witz des Ganzen, dass wir die Form der Erzählung mehr genossen als das Erzählte, dass Marguerite und Julien nur Platzhalter waren für ein verbotenes Begehren, das kein Halten kennt, das in Bildern davonrennt, sich nicht greifen lässt, nicht mal von diesem Film –, sondern dass Donzelli sie auf einmal zu kennen glaubt; dass aus dem bunten Märchen auf einmal Tragödie werden soll, aus den Bewegungsaffekten größere Emotionen; dass der Film seine Flüchtigen schließlich doch einfängt, noch lange vor ihrer eigentlichen Festnahme.
So tut Marguerite and Julien auf einmal so, als hätte er uns nie zu überwältigen versucht, als hätte er uns die ganze Zeit eine Geschichte erzählt, als wären wir die kleinen Mädchen, die in der erzählerischen Klammer die Legende von Marguerite und Julien erzählt bekommen, als wären diese Mädchen nicht selbst Teil dieses Films gewesen und seines Versprechens zu überfordern. Dass Donzelli diese Klammer dann nicht einmal schließt, dass sie diese Erzählebene irgendwann vollends ignoriert oder vergisst, bezeugt nochmals, wie sich ihr Film selbst sabotiert. Irgendwann wirkt er geschrumpft, ganz brav und harmlos, trotz all der Farben und Kostüme, trotz all der ganzen Bewegung; nicht mehr flüchtend, sondern ganz und gar flüchtig.
Hier kann man sich den Film auf der Website von My French Film Festival ansehen: www.myfrenchfilmfestival.com/de/movie
Der Text ist ursprünglich am 19.5.2015 erschienen.
Neue Kritiken

Primate

Send Help

Little Trouble Girls

White Snail
Trailer zu „Marguerite and Julien“

Trailer ansehen (1)
Bilder
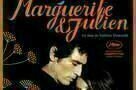



zur Galerie (5 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.














