Manifesto – Kritik
VoD: Jetzt auch als Zerstreuung: Julian Rosefeldts Filminstallation Manifesto kommt in einer linearen Fassung ins Kino und zeigt die Kunst des 20. Jahrhunderts als hitzige Debatte mit indiskretem Charme.

Etwas üppig wirkt Rosefeldts Arbeit Manifesto in der Kinofassung, aber auch als solche macht sie sich effektvoll. Manifeste aus der bildenden Kunst, Architektur, Film und Politik, im Laufe der letzten hundert Jahre geschrieben, schießen und fließen hier wie aus dem Füllhorn. Bilder dazu: überwiegend Klischees, Filmzitate, Augenzwinkern. Die ursprünglich parallel und im Loop projizierten Szenen – zwölf waren es insgesamt – sind jetzt in- und aneinander montiert, teilweise auch gekürzt. Cate Blanchett, die Schauspielerin und der große Star, nimmt mithilfe von Maske und Kostüm in Manifesto die ganze Zeit über verschiedene Rollen an. Sie ist ein obdachloser Mann, eine Wissenschaftlerin im Schutz-Overall, eine Börsenmaklerin, eine Nachrichtensprecherin und eine Nachrichtenkorrespondentin. Sie ist eine Grabrednerin ist eine russische Choreografin ist ein Rockstar. All das vollführt Blanchett, die Könnerin in eigener Sache, erwartungsgemäß perfekt, affektiert, pathetisch. Ihr Gesicht, wie immer und diesmal bis zum Äußersten, wird zu einer Projektionsfläche für sich, wird zu einer großen Kinoleinwand.
Dada is still shit

Um die Qualität dieses Gesichts weiß der Film, und die Kamera nähert sich ihm mehrfach über gezielte Travellings, deduktiv vom Nebensächlichen zum Eigentlichen, von Totalen zu Nahaufnahmen. Meist von weit oben schwenkt sie über die kunstvoll arrangierte Mise-en-scène, die sorgsam verstreuten Indizes, die urbane Landschaft. Sie rückt näher heran und bleibt, sie hält die Sprechende fest im Bild, als diese – jedes Mal ein wenig anders – sich im Sprechen hochsteigert. Blanchetts Figuren geben Texte wieder, die sich vor keinem rhetorischen Schachzug, ja vor keinem Kunstgriff scheuen. Sie fordern nach künstlerischer Freiheit, radikaler Erneuerung, Konsequenz, Provokation. Sie verallgemeinern schamlos oder gehen in jedes Detail: washing, cleaning, cooking (ganz toll: Manifesto for Maintenance Art von Mierle Laderman Ukeles). Sie nehmen sich ernst und locken mit Sinn, der sich nicht zwingend einstellt. Die Manifeste legitimieren sich oft ex negativo, um im nächsten Zug das eigene „ich“ und „wir“ mit Schaum vorm Mund und geschwellter Brust über den Haufen zu werfen. All current art is fake, oder etwa: Dada is still shit.
Resolute Mehrstimmigkeit

Schöner noch als der indiskrete Charme der Parolen ist die Verbindung des Gesprochenen zu den Bildern. Sie ist nicht so leicht zu benennen – der ursprüngliche Kontext, die historische Entstehungszeit sind bewusst abwesend. Rosefeldt bebildert die Manifeste nicht einfach durch lediglich Naheliegendes, er konfrontiert sie aber auch nicht nur mit Gegensätzlichem. Und doch ist beides der Fall. In Manifesto kultiviert er den Doppelsinn, die Synthesen, interessiert sich für die Wirkung, die Anschlüsse, das Sinnliche. Zu der futuristischen Ode an die Schönheit der Geschwindigkeit erfindet er seine Bilder der Börse, löst alles dann aber ganz in der Zeitlupe auf. Er lässt Blanchett als Grabrednerin die dadaistische Abschaffung des Künftigen ausrufen. Und doch ist das Setting bourgeois und der Ton comme il faut. Worum es in Manifesto geht – Wiederholung, Variation, Sich-Ausschließendes –, wird in der linearen Schnittfassung umso lauter und deutlicher. „Kunst des 20. Jahrhunderts als hitzige Debatte zu sehen, das ist lustig“, erzählt Rosefeldt. Er befragt die Kunstgeschichte, indem er aus vielen Texten seinen eigenen „zusammenschustert“ und indem er, ganz allgemein, die retrospektiv hineinprojizierte Ordnung als Konstrukt offenbart. Es geht ihm um die Schönheit der Texte in ihrer Gesamtheit, um die resolute Mehrstimmigkeit, um Einklang und Widerworte: Piece of pie, piece of shit. Bei allem Ernst ist Manifesto ein Witz, der auch so funktionieren könnte, hier aber aus dem Inneren des gemeinten Sinnzusammenhangs gemacht wird.
Manifesto macht sich im Kino angreifbar
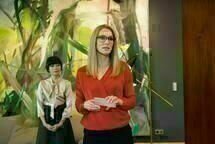
Interessanter noch als dieser Witz ist die Grundsatzfrage, die Rosefeldt in einem Interview zur Sprache brachte: Wie erreicht die Kunst diejenigen, die sie von sich aus nicht suchen, die nicht von vornherein einverstanden sind? Im Kino und Fernsehen? Eine „Seitwärtsbewegung“, sagt er, die er von sich aus gar nicht anstrebte. Die finanzielle Beteiligung des Bayerischen Rundfunks verpflichtete den Künstler jedoch von Anfang an dazu, aus den einzelnen Videos zusätzlich eine lineare Fassung zu erstellen. Filme in Museen gibt es seit geraumer Zeit, aber mit Manifesto wird ein Ausstellungsstück ins Kino gebracht. Was sich damit in der Tat ändert und gewissermaßen selbst zum Thema wird, ist das Kräfteverhältnis zwischen Kunstwerk und seinen Betrachtern. Das, was in der frühen Filmtheorie, etwa von Walter Benjamin, geäußert wurde, gibt uns noch heute zu denken: in dem auratischen Raum des Museums sind es die Kunstwerke, die ihre Ansprüche an den Betrachter stellen, die ihm Kontemplation und Nachdenken abverlangen. Das Kino war in diesem Sinne schon immer demokratischer, das dort Gezeigte musste den Erwartungen der Zuschauer gerecht werden, es musste sich bewähren. Die Zuschauer haben eine Absicherung, die einerseits mit ihrer Mehrzahl, andererseits mit den Rückenlehnen ihrer Sessel zu tun hat. Das Publikum im Kino, schrieb Benjamin, ist „ein Examinator, aber ein zerstreuter“. So gesehen macht sich Manifesto geradezu angreifbar. In der Etymologie des Titels – das lateinische manifestus heißt „sichtbar, handgreiflich gemacht“ – ist das ja auch bereits angelegt.
Der Film steht bis 16.04.2022 in der BR-Mediathek.
Neue Kritiken

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple

Silent Friend
Trailer zu „Manifesto“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (12 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.










