Die wilden Boys – Kritik
VoD: Insel des Begehrens. Bertrand Mandico schickt in Die wilden Boys fünf Pubertierende als Resozialisierungsmaßnahme auf eine Schiffreise inklusive sexueller Selbstentdeckung und will Geschlechterrollen verflüssigen.

Es sei ein Unfall gewesen, sagen sie, und sie könnten sich an nichts mehr erinnern. Sie seien ja auch betrunken gewesen. Die Literaturlehrerin habe ihnen den Rum gegeben, als sie mit ihr eine Szene aus Macbeth nachgespielt hätten. Sie habe mitgetrunken, ja. Und sie habe eben zuerst einen von ihnen angefasst. Am Oberschenkel. Sie habe doch gefesselt werden wollen, sagen sie, ganz sicher.
„We all wanted to be actors“

Das Verhör als Vorstellungsrunde: So lernen wir die fünf titelgebenden Jungs in Bertrand Mandicos Die wilden Boys kennen. Tanguy (Anaël Snoek), Romuald (Pauline Lorillard), Hubert (Diane Rouxel), Sloan (Mathilde Warnier) und Jean-Louis (Vimala Pons) stammen allesamt aus gutem Hause, tragen also Hemden, Hosenträger und Sakkos, letztere gerne auch mal lässig über der Schulter. Sie sind jedoch gelangweilt von dieser Welt, in die sie unausweichlich hineinwachsen werden, und aus der Filmgeschichte wissen wir, dass gelangweilte Männercliquen nie ein gutes Zeichen sind. Als Gruppe verbindet die fünf die pubertäre Lust am Grenzüberschritt und ihre überschüssige sexuelle Energie, die sich gleich zu Beginn von Die wilden Boys im Gewaltexzess entlädt. Die Literaturlehrerin wird von ihnen bei der Theaterprobe an ein Pferd gefesselt, begrapscht, misshandelt: „We all wanted to be actors.“

Beim Verhör stehen sie nun ohne die Masken da, die sie während sie ihrer „show“ noch trugen (auch das fast immer kein gutes Zeichen), und beteuern ihre Unschuld. Fast wirken jetzt ihre Gesichter, die Seitenscheitel und großen Augen, als eigentliche Maskerade. Niedlichkeit als Verteidigungsstrategie, die Wild Boys sind sich ihrer Wirkung sehr bewusst, doch es hilft alles nichts, die Erwachsenen haben sie durchschaut. Von den Eltern werden sie auf eine Schifffahrt geschickt, mit einem autoritären Kapitän (Sam Louwyck), der sie auf die rechte Bahn zurückführen will. Sein Boot heißt „cold world“, und entsprechend ist die Stimmung an Bord. „My ideals are gone“, sagt einer der Jungs, meint er das ernst?
Körperflüssigkeiten und Fruchtsäfte

Erlösung verspricht eine Insel, die gemeinsam angesteuert wird. Jene „island of pleasure“ lockt mit Früchten in Phallusform und verschiedenen Körpertransformationen. Spoiler: Den Jungs wachsen plötzlich Brüste, und Penisse fallen ab. Ein Blick auf die Besetzungsliste lohnt sich insofern, als dass doch die Darstellenden abseits der Filmrealität Frauen sind. Die wilden Jungs zuvor waren demnach eh immer nur gespielt. Alles wirklich nur „show“, ein bisschen Verwechslung und Spiel im Spiel. Shakespeare lässt als leise Erinnerung an die erniedrigte Literaturlehrerin (Elina Löwensohn) vom Anfang grüßen.

Wie seinen Figuren fällt es dem Film schwer, mit Flüssigkeiten Maß zu halten, seien es die Körperflüssigkeiten der Darstellenden (Sperma, Schweiß, Spucke), seien es die Fruchtsäfte auf der Insel – und in welcher Dosis lassen sich Alkohol und das tobende Wasser des Meeres als dramaturgisches Mittel nutzen? Das Spritzende und Überbordende ist für Bertrand Mandicos Faszination, Rausch, Ekstase und die Überwältigung am eigenen Selbst zu erzählen, gerade gut genug.

Ein ziemlich voller Film also, in mehrfacher Hinsicht, auch in ästhetischer, wenn Pascale Granels schwarz-weiße, analog gedrehte Bilder auf grellbunte Halluzinationen treffen. Die Bildebene in Die wilden Boys funktioniert stark assoziativ und fließend. Nur ihre kulturgeschichtlichen Querverweise, mal mehr, mal weniger deutlich, schaffen Momente des Anhaltens und Reflektierens dessen, was da gerade an der Oberfläche sichtbar ist. Ausgangspunkt für das Drehbuch bildet William S. Burroughs Roman The Wild Boys – A Book of the Dead von 1971, an dem sich Mandico aber nur lose orientiert. Stattdessen schüttet er einiges zusammen und rührt gut durch: Western-, Abenteuer-, Piraten- und Splatter-Filme, Erinnerungen an homoerotische Männerbünde und tiefdunkle, romantische Ideen von Schifffahrt à la Joseph Conrad.
Verweiblichung, Verweichlichung

Unter allem liegt aber vor allem Shakespeare; nicht zuletzt in Mandicos Griff in die Trickkiste, die wilden Jungs eben mit weiblichen Darstellenden zu besetzen – also genau umgekehrt wie einst am Globe Theatre. Das Erstaunliche an Die wilden Boys ist aber, dass er, so uneindeutig er Bilder, Sounds und Erzählmuster macht, gar nicht so wahnsinnig anders über Geschlechterrollen nachdenkt. Ist die Gewalt im Film eine andere, weil sie eigentlich von Frauen ausgeübt wird? Irgendwie nicht. Kommt der Besetzungstwist tatsächlich überraschend? Irgendwie auch nicht. Jede Irritation, die wir bei unserem Versuch empfinden könnten, die Körper der Darsteller/Figuren im Hinblick auf ihr Geschlecht zu lesen, löst der Film schließlich selbst auf, indem er sie in seine eigene Logik überführt.
Die Insel, so wird an einer Stelle erklärt, verwandle Männer in Frauen. Die Zähmung der wilden Jungs ist mit der Verwandlung zur Frau abgeschlossen – so einfach kann es manchmal sein. Dass hier Verweiblichung und Verweichlichung gleichgesetzt werden, ist ziemlich komisch, zumal der Film seine Vorstellung von Geschlecht allein an körperlichen Merkmalen festmacht. Statt den Besetzungstrick zu nutzen, um anders über Männlichkeit, Geschlechterbilder und -konstellationen nachzudenken, schreibt Die wilden Boys allseits bekannte Rollen fort und versteht Körper wahnsinnig konkret. Als wären sie Grenzen, die sich im Kino nicht durchbrechen ließen.
Der Film steht bis zum 13.07.2021 in der Arte-Mediathek.
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Trailer zu „Die wilden Boys“
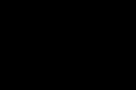
Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (15 Bilder)










1 Kommentar