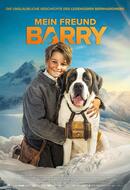Le Journal d'un vieil homme – Kritik
In stiller Andacht vor dem Leben: Bernard Émond nimmt Beichten ab und verzichtet auf die Absolution.

Erst ganz am Ende, da scheint jene Tendenz zum Religiösen durch, die dem international recht wenig bekannten, in seiner Heimat Québec aber äußerst renommierten Filmemacher Bernard Émond nachgesagt wird. Da steht Nicolas (Paul Savoie) im Schnee, und wie schon den gesamten Film über lauschen wir seinen schwermütigen Gedanken, die durchdrungen sind vom Wissen um den baldigen Tod, aber doch klar im Diesseits verankert. Hier nun erreicht die zuvor in konkreten Situationen beheimatete Traurigkeit eine Transzendenz, hier nun setzen sich die verstreuten Beobachtungen zu einem Urteil über die menschliche Existenz als solche zusammen: Ohne ein großes Ganzes, ohne jeglichen Bezug zu etwas Höherem, so denkt Nicolas, ist das Leben doch in der Tat sinnlos, weil jede noch so kleine Unsicherheit gleich zu einer Krankheit wird, so wenig heilbar wie der Krebs in seinem Körper. Die Reue über den lebenslang gepflegten Widerstand gegen den Glauben, über das selbst auferlegte Scheitern am göttlichen Trost, sie ist jedoch nicht Schlusspunkt von Le journal d’un vieil homme, sie wird rasch unterbrochen. Dann stapft Katia (Marie-Ève Pelletier) auf ihren Stiefvater zu, und der Film widmet sich wieder ganz seinem menschlichen Zentrum, der Beziehung zwischen zwei Verstimmten: Nicolas, der mit dem baldigen Tod zu kämpfen hat, und Katia, die mit dem Leben zu kämpfen hat, noch immer, und diesen Kampf zu verlieren droht, so wie Nicolas das Leben selbst verliert.
In stiller Andacht vor dem Leben

Einfach ist dieser Film, und das im besten Sinne. Mühelos setzt er die filmischen Ebenen zu einem organischen Ganzen zusammen: die Tschechow-Vorlage (in der Langweiligen Geschichte ist auch die religiöse Sehnsucht schon angelegt), die ruhige und doch aufgewühlte Erzählerstimme des Protagonisten, die schlichte Poesie der Bildsprache, die Musik von Schostakowitsch im Hintergrund oder auch mal im Vordergrund. Es gibt keinen doppelten Boden, keinen versteckten Effekt, Émond legt jeden filmischen Moment völlig offen. Eine Erinnerung im Close-up wird zu einer Rückblende wird zum Kinderblick der jungen Katia, die etwas über Giraffen wissen will, und Nicolas’ Voice-over setzt ein: „Sie war so neugierig.“ Stets die möglichst genaue Annäherung an die in einem Augenblick liegende Stimmung, die Suche nach emotionaler Aufrichtigkeit ohne Angst vor Schwermut, aber auch ohne jeden Hang zum Sentimentalen – selbst wenn eine bittere Erkenntnis hier schon mal mit Streichern begleitet wird.
Dabei geht dem Film selbst jegliche fatalistische Distanz ab, die seine Figuren bisweilen umtreibt. Émond ist kein kühler Sezierer der Hoffnungslosigkeit, sondern emphatischer Zuhörer für die Hoffnungslosen. Vor allem gegenüber dem seine grauen Gedanken mit schonungsloser Ehrlichkeit offenlegenden Nicolas ist er ein Beichtvater, der gleichwohl auf die Geste der Absolution verzichtet, weil es sie ja gar nicht braucht, weil das Kino Émonds vielleicht einen göttlichen Blick denkt, aber eben keine göttliche Autorität. Le Journal d’un vieil homme verweilt eher in stiller Andacht vor dem Leben, als Aussagen über es zu treffen oder über diese zwei Menschen zu urteilen, die an seinen Mühen verzweifeln, sie gar zu erlösen. Der Film weiß, wie einfach es ist, den anderen zu ermuntern, sein Leben zu verändern; wie schwer es ist, das für sich selbst zu tun. Deshalb ermuntert er nicht selbst noch, sondern nickt höchstens aufmunternd zu.
Tragik der Selbstlosigkeit

Das Wissen um ein baldiges Ende nutzt Nicolas nicht für letzte Wünsche, er zieht sich innerlich zurück, lebt weiter, so gut es eben geht: als Professor der Medizin, als Ehemann einer schon lange nur noch theoretisch geliebten Frau, als Vater einer pubertierenden Tochter. Die aus der Unzufriedenheit über das eigene Leben erwachsene Bitterkeit trägt er ganz mit sich selbst aus, lässt sie niemals auf andere los. Das untergehende Abendland weiß er tief in sich drin: Vehement rügt er einen Kollegen, der von der zunehmenden Verdummung seiner Studenten faselt, stoisch befolgt er die Anweisungen seiner Frau, selbst wenn er sie für Unsinn hält. Dass er die Bürde des eigenen Unglücks aufnimmt, das ist wohl auch Teil dieses Unglücks: jene frei gewählte Selbstlosigkeit, deren zerstörerischer Anteil nur schwerlich zu scheiden ist von dem, was für ein menschliches Miteinander notwendig ist.
Der unmögliche Schauspieler

Paul Savoie verkörpert Nicolas mit wacher Intensität und doch stets unaufdringlich. Sein Spiel illustriert weniger die Gedanken im Voice-over und die existenziellen Untertöne, als dass es sie um eine physische Note ergänzt, weil Sprache eben unvollkommen ist, auch und gerade wenn sie große Emotionen in kurze Worte zu verpacken versucht; was genau hat es auf sich mit der „indifférence“, mit der „anxiété“? Es braucht den begleitenden Blick eines alten Mannes aus dem Fenster, das Bild eines mit schmerzlich wachen Augen auf dem Sofa liegenden und von Schlaflosigkeit geplagten Nicolas, um sich diesen Gefühlen wenigstens noch ein wenig weiter anzunähern. Doch auch die Bilder allein reichen nicht aus für das, was Émond vorhat; dem Schmerz des Daseins ist mit naturalistischem Schauspiel nicht beizukommen. „Niemand könnte dich spielen“, sagt Katia, selbst gescheiterte Schauspielerin, einmal, weil sie ihren Stiefvater so bewundert, für so einzigartig hält. „Mich oder Michel könnte jeder Amateur spielen, dich niemand.“ Ein tieftrauriger Satz, der den Kern von Katias Unzufriedenheit, aber eben auch Émonds Kino trifft: Um dem alten Mann und der Substanz seines Tagebuchs gerecht zu werden, reicht das Schauspiel nicht aus; braucht es die Literatur für die Gedanken, die Musik für die Schwermut, die langsame Kamerafahrt für die Mühsamkeit des Lebens.
Neue Kritiken

No Bears

Scarlet

Marty Supreme

Father Mother Sister Brother
Bilder zu „Le Journal d'un vieil homme“




zur Galerie (5 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.