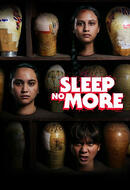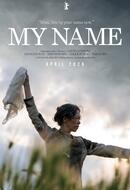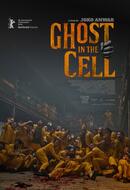L' homme-vertige: Tales of a City – Kritik
Berlinale 2024 – Forum: In L’homme-vertige porträtiert Malaury Eloi Paisley feinfühlig ihre Heimat Guadeloupe, eine Insel der Verzweiflung ohne Leuchtturm der Hoffnung. Ein bewundernswerter Film.

„Wenn es Himmel, Hölle und Fegefeuer wirklich geben sollte, werde ich nicht viel Zeit im Fegefeuer fristen müssen, auch nicht in der Hölle. Denn dieses Leben fühlt sich schon an wie die Hölle.“ Pointe-à-Pitre auf Guadeloupe, französisches Übersee-Département in der Karibik. Ti Chal, der diese Sätze sagt, ist einer der Protagonist*innen von Malaury Eloi Paisleys Langzeitbeobachtung einer sich auflösenden Stadt und den geisterhaften Gestalten, die sie durchstreifen.
Moderner Paternalismus
Andere Verortungen liefert die Architektur: „Crak Land – Fuck the Police“ ist auf eine Hauswand gesprüht. Ganze Wohnblöcke werden abgerissen, verantwortlich ist die Immobilienfirma mit dem sprechenden Namen Avenir Déconstruction – Abbauprojekt Zukunft. Der Name einer Telenovela, die bei Ti Chal zuhause läuft, sagt es noch drastischer: L’envers du paradis (Die Kehrseite des Paradieses). Aufgemalte Palmen zieren die Betonfassade eines Hauses, das wohl auch bald nicht mehr stehen wird.
Bilder wie diese verdichtet L’homme-vertige in präzisen Montagesequenzen, auf der Tonspur manchmal unterlegt von verzerrtem Jazz und Baulärm, aber ohne jeden Hang zum Plakativen. Die Szenerie ist nun mal düster, die Apokalypse entweder schon vorbei oder nicht mehr weit weg. Wer fort von hier will, ins Ausland – und viele, vor allem die Jüngeren wollen das –, kann gleich hierbleiben, schließlich lebt man schon in der Fremde. Wir haben Diaspora zuhause.
Als junger Mann hat Ti Chal für die Kubanische Revolution und ein vom Imperialismus befreites Lateinamerika gekämpft; Fidel Castro hat ihm einmal eine Zigarre spendiert. Jetzt ist er wegen eines Lungenleidens auf den Beatmungsschlauch angewiesen, spricht mit vielen Pausen und zwischen den Pausen vom Tod. Auf seiner Heimatinsel steht der geopolitische Vatermord am französischen Kolonisator noch aus, derweil sich die paternalistischen Unterdrückungsmethoden nur in andere, sogenannte moderne Gewänder kleiden.
„Ist das Leben nicht schön?“

Neben der Architektur erzählen vom (Über-)Leben gezeichnete Körper die Geschichten dieser Insel, und es lohnt sich, ihnen zuzuhören. Die Regisseurin hat das getan, über sieben Jahre hinweg – eine beachtliche Art sich kennenzulernen, Beziehungen zu knüpfen, die auch außerhalb des Films Bestand haben. Paisley selbst ist hier aufgewachsen, hat aufgrund der Perspektivlosigkeit (auch die Infrastruktur für Kunstschaffende liegt brach) viel Zeit im Ausland gelebt. Die Zustände hier, sagt Ti Chals Pflegerin, seien eigentlich zu traurig, um darüber einen Film zu machen. Es ist ein großes Glück, dass trotzdem einer daraus wurde, zumal einer mit einem so fein kalibrierten (ästh)ethischen Sensorium. Mit der Fähigkeit zur Errettung äußerer Wirklichkeit und innerer Unruhe.
Manche der Menschen, die der Film begleitet, sind obdachlos, manche drogenabhängig; alle – Ti Chal, Kanpèch, Priscilla, Bernard, Jean-Charles, Eric, Eddy – führen ein prekäres Leben an den Rändern, auch an dem der Verzweiflung. Eddys Cracksucht führt ihn zwischenzeitlich in verschiedene Entzugskliniken, Paisley trifft ihn erst Jahre später wieder. Er ist rückfällig geworden, traut sich aus Angst vor den Leuten, denen er Geld schuldet, nicht auf die Straße und aus Scham nicht zu seiner Familie. Während er der Regisseurin von seiner Einsamkeit berichtet, hängt im Bildhintergrund ein T-Shirt mit der ironischen Aufschrift „Elle n’est pas pas belle la vie?“ – Ist das Leben nicht schön?
Liebe beim Rasieren

Wenn es noch Hoffnung gibt, dann in der Kunst. L’homme-vertige schöpft aus der Tradition des Spiralismus, ein dezidiert karibische Protestpoesie, die auf den haitianischen Schriftsteller Frankétienne zurückgeht und eine avantgardistische Montage von Formen und Gattungen mit radikaler politischer Kritik verbindet. Die Menschen in Paisleys Film produzieren ihre eigene Lyrik, geschöpft aus Alltagssituationen.
Eric ist den Büchern zugetan, zitiert Passagen aus Quelque part sans connaître [Irgendwo ohne zu wissen] von Joël Beuze, ein Fragment gebliebener Debütroman von 1979. Im Interview mit dem Forum verrät Paisley, dass sie zunächst vergeblich versucht habe, Beuze zu erreichen, bis sie herausfand, dass er monatlich seine Post verbrennt. Er hat ihr trotzdem erlaubt, den Roman für den Film zu verwenden. Zu seiner Würdigung plant Paisley eine Video-Installation mit nicht verwendeten Bildern aus L’homme-vertige.
Falls das noch nicht ausreicht, um die bewundernswerte Arbeitsweise der Regisseurin zu beschreiben, hier ein letztes emblematisches Bild: Ti Chal, dessen Gesundheitszustand sich im Laufe des Drehs zunehmend verschlechtert, schafft es nicht mehr, sich selbst zu rasieren. Er bittet Paisley um Hilfe: „Du musst alles geben. Vielleicht sogar ein bisschen Liebe.“ Und Paisley tut das nicht nur beim Rasieren. Respekt und Liebe erfordern scharfe Waffen.
Malaury Eloi Paisley hat einen feinfühligen, auf gegenseitigem Vertrauen basierenden Weg gefunden, das Leid von echten Menschen – und ihre Suche nach Heilung – filmisch zu bezeugen, ohne dass der Kamerablick die kolonialen Ausbeutungsverhältnisse reproduziert. Guadeloupe ist eine Insel der Verzweiflung ohne hoffnungsspendenden Leuchtturm. Ihre Bewohner*innen, dauerschwindelerprobt und angeschwindelt von der Politik eines Staates, der nicht der ihre ist, bleiben standhaft, trotz allem.
Neue Kritiken

Ella McCay

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo

No Other Choice

Ungeduld des Herzens
Trailer zu „L' homme-vertige: Tales of a City“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (5 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.