Jimmy P. - Psychotherapie eines Indianers – Kritik
Therapie als Begegnung.

Selbst in seinem bisher geradlinigsten Film gelingen Arnaud Desplechin immer wieder kleine Überraschungen: Gerade hat der französische Ethnologe und Psychotherapeut Georges Devereux (Mathieu Amalric) angefangen, ein Vertrauensverhältnis zu seinem Patienten zu schaffen, dem titelgebenden „Prärie-Indianer“ und Kriegsveteranen James Picard (Benicio del Toro), da werden die Therapiesitzungen auch schon unterbrochen: Devereux bekommt unerwarteten Besuch von seiner Geliebten Madelaine (Gina McKee), einer Figur, die freilich nicht Teil des wissenschaftlich gehaltenen Behandlungsberichts von 1951 ist, der Jimmy P. zugrunde liegt. In einer beiläufigen Szene wird diese Madelaine ihr eigenes Verständnis der Psyche des Menschen mithilfe von Matroschka-Puppen darstellen, die sie ineinander steckt: die Seele ins Herz, das Herz in den Geist, den Geist in den Körper und den Körper in die Persönlichkeit.
Was von außen erkennbar bleibt, das ist also die Persönlichkeit, zusammengesteckt aus mehreren Teilen und ähnlich undurchsichtig wie die meisten Figuren des französischen Regisseurs. Niemals sind sie mit festen Eigenschaften gezeichnet, sondern erscheinen in ihrer Unvorhersehbarkeit zugleich faszinierend eigenwillig wie radikal unbestimmt. Desplechins Filme zeigen uns keine fertigen Persönlichkeiten, sondern lassen uns an ihrer Entstehung teilhaben, jede Geste, jede Aussage und jeder Blick fügt der Figurenskizze etwas hinzu. Dieser scheinbar endlose Prozess, der die Menschen auf der Leinwand so unnahbar macht, das ist vielleicht ein Grund für den trotz großer Distanz zu selbstverliebtem Kunstkino sperrigen Charakter von Desplechins Filmen. Jimmy P. ist leichter zugänglich als die meisten seiner französischen Arbeiten, ein gelungenes Zusammenspiel aus erzählerischer Stringenz, eleganter Montage und Howard Shores lauter, aber stets angemessen eingesetzter Filmmusik. Doch dahinter spukt auch dieses Mal ein inszenatorischer Eigensinn, der die Handlung immer wieder entrückt, neu perspektiviert und mit visuellen Ideen überhäuft.

Unter der Persönlichkeit steckt dann der Körper, vor allem der Körper des James Picard, in den USA der 1950er Jahre noch stärker mit dem wahrgenommenen Mangel der Andersartigkeit behaftet. Trotz der detailverliebten Ausstattung ist Jimmy P. zwar kein klassisches Period Piece und die Nachkriegszeit an sich für Desplechin kaum von Interesse. Doch die selbst schizophren anmutende Behandlung, die Picard als „Indianer“ wie Kriegsveteran erfährt und gegen die er sich zunehmend wehrt, zeigt, wie sehr auch über den Körper vermittelte Fremdzuschreibungen zur Persönlichkeit gehören. Medizinisch ist dieser Körper gesund: Die verschiedenen Experten im Krankenhaus von Topeka können keine physiologische Ursache für die heftigen Kopfschmerzattacken finden, die Picard immer wieder überfallen – und die Kameramann Stéphane Fontaine in gelegentliche Erschütterungen des Bildrahmens übersetzt.

Wenn’s der Körper nicht ist, ist’s wohl der Geist. Das Motiv der Psychotherapie ist Desplechin nicht fremd, schon in früheren Filmen redeten seine Figuren manchmal selbst im Alltag so schonungslos und brutal wie auf der berüchtigten Couch. So explizit und allgegenwärtig wie in Jimmy P. tauchte die Psychoanalyse freilich noch nie auf: Desplechin nimmt sie dabei weniger als Theoriegebäude denn als eine konkrete Praxis ernst, die Sitzungen – mal herzliche Plauderei, mal knallhartes Duell – bieten dabei ein dankbares Setting für großes Schauspielerkino. Mathieu Amalric, Stammdarsteller Desplechins und dabei ironischerweise sonst oft selbst in Rollen mit psychischen Problemen, spielt den eigenwilligen Analytiker Devereux als seinerseits etwas neurotischen, aber liebenswerten Mann, der um ein respektvolles Verhältnis mit seinem Patienten bemüht ist. Vor allem del Toro aber gelingt eine grandiose Verkörperung Picards, subtil und dennoch mit einer faszinierenden Präsenz, wobei er völlig ohne jene überdeutliche Performance auskommt, in die Amalrics Darstellung manchmal zu kippen droht. Trotz der zwei zentralen Hauptdarsteller ist Jimmy P. kein bloßes Kammerspiel geworden. Desplechin lässt zwischen den Sitzungen immer wieder frischen Wind von draußen hinein, lässt Blicke ins Umfeld des Krankenhauses, auf andere Figuren, schließlich sogar in Picards Träume zu.

Gelangen wir über diese filmische Freilegung des Geistes nun ins „Herz des Indianers“? Dass Devereux als Freudianer eine ganze Reihe von ödipalen Konstellationen findet, das wirkt in seiner Schlichtheit zwar stellenweise unbefriedigend. Doch interessiert sich der Regisseur auch nicht primär für die richtige Diagnose oder das Potenzial von Devereux’ heute fast vergessener Ethnopsychoanalyse. Der unkonventionelle Wissenschaftler kreist eher um Picards Unbewusstes, der Film mit ihm, aber es ist nicht die Freilegung der Wahrheit hinter dem Unbewussten, sondern dieses Kreisen selbst, das den entscheidenden therapeutischen Effekt zu haben scheint. Denn nicht zuletzt ist Jimmy P. auch ein Film über eine ungewöhnliche und zunehmend zärtliche Freundschaft, die das therapeutische Verhältnis immer wieder in den Hintergrund drängt.

Den Begriff der Seele schließlich benutzt Devereux nicht als metaphysisches Prinzip, sondern im Kampf gegen herrschende Modelle der Psychiatrie. Hatte er schon zu Beginn den Psychologen des Krankenhauses bewiesen, dass es sich bei Picard nicht um einen Fall von Schizophrenie handelt, rügt er seinen Patienten nun selbst, als dieser von der Heilung seines „Komplexes“ spricht – und nennt den Seelenschmerz als einzig gültige Diagnose. Der orthodoxe Freudianer Devereux war eben zugleich ein Dissident, der von den klassischen Einordnungen und Kategorisierungen der Psychoanalyse nicht viel hielt und sich ihnen zu entziehen versuchte. Auch Desplechins Kino ist eines, das sich fortwährend entzieht. Jimmy P. erlaubt zwar keine Diagnose, aber doch zumindest einen neuen Blick auf seine Filme, denen man ebenso wie dem „Prärie-Indianer“ nicht mit einer Analyse beikommt, die nach Modellen sucht, nach Genres, Figuren und einer Handlung, sondern denen man vielleicht lieber einfach begegnet. Im Inneren der Desplechin-Puppe stoßen wir auf keinen Grund, sondern nur immer tiefer ins Unbewusste schmerzender Seelen.
Neue Kritiken

Douglas Gordon by Douglas Gordon

If Pigeons Turned to Gold

Don't Come Out

Dead of Winter - Eisige Stille
Trailer zu „Jimmy P. - Psychotherapie eines Indianers“
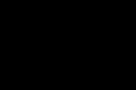


Trailer ansehen (3)
Bilder




zur Galerie (6 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.















