Inu-oh – Kritik
Ein blinder Mönch und ein dreiäugiges maskiertes Wesen geben vor ekstatischem mittelalterlichem Publikum ein Konzert. Inu-Oh greift jahrhundertealte japanische Erzähltraditionen auf und webt sie zu einer Fantasy-Anime-Rockoper.

Manche Geschichten existieren schon seit Jahrhunderten, wenn nicht sogar Jahrtausenden, im Gedächtnis der Menschen. In Liedern besungen oder aufgezeichnet in alten Schriften, dann und wann von zeitgenössischen Geschichtsschreibenden reinterpretiert, angereichert mit den Perspektiven ihrer Zeit – sodass die Geschichte auf ihrem Pfad durch die Zeit hier und da unerwartete Richtungen einschlägt. Inu-Oh ist ein Beispiel dafür. Der Film basiert auf Hideo Furukawas Roman Heike Monogatari: Inu-Ō no Maki (2017), der wiederum eine moderne Interpretation der Heike Monogatari ist, eines mittelalterlichen Geschichtenepos über Machtkämpfe, Loyalität und magische Artefakte. Regisseur Masaaki Yuasa nimmt diese jahrhundertealten Erzählstränge auf und webt sie in seinem neuen Film zu einer Fantasy-Anime-Rockoper.
Mittelalterliche Proto-Rockstars

Inu-Oh (Avu-chan) ist ein Wesen, wie es nur in Cartoons glaubwürdig existieren kann: Seine linke Hand wächst ihm aus dem Kopf, sein rechter Arm ist sechsmal so lang wie ein ausgewachsener Mensch. Drei Augen sind schief im Gesicht verteilt und hinter einer Kürbismaske versteckt. Inu-Oh wurde im Mutterleib mit einem Fluch belegt. Heimlich beobachtet er seinen Vater (Kenjiro Tsuda) bei den Proben seiner Nō-Theatertruppe und tanzt die Schritte im Schatten der Scheune nach. So geschieht es, dass das skurrile Wesen nachts auf einer Brücke in die Arme des Biwa-Mönchs Tomona (Mirai Moriyama) rennt. Im Gegensatz zu den meisten erschrickt Tomona nicht vor dem Anblick. Denn Biwa-Mönche, die mit ihrer Laute das Land bereisen und der Bevölkerung epische Gedichte vortragen, sind nach Tradition blind.

Tomona und Inu-oh stehen in zwei unterschiedlichen Erzähltraditionen. Die Biwa-hōshi-Tradition widmet sich den epischen Erzählungen historischer Ereignisse. Das Nō-Theater konzentriert sich auf Mythen und Sagen. Regisseur Yuasa behauptet durch die Hauptfiguren eine hypothetische Revolution der beiden Kunstformen, indem die beiden sich zusammentun und die Kunst auf den Kopf stellen: Tomona lässt den traditionellen Glatzkopf zurück und lässt sich die Haare lang wachsen. Täglich spielt er auf der Brücke mit nacktem Oberkörper, wie eine Art mittelalterlicher Steven Tyler mit elektrisch kreischender Biwa-Laute, vor einer ekstatischen Stadtbevölkerung. Inu-Oh steht maskiert am Flussbett unter der Brücke, seine langen Gliedmaßen unter einem Gewand versteckt, und verkörpert die Lieder in spektakulären Bühnenshows. Sie erinnern nicht nur an Rockstars, sie sind regelrechte Proto-Rockstars samt Groupies, Kunstnebel und aufwendigen Video-Projektionen auf Leinwänden.
Behauptung großer Kunst

Inu-Oh hat einen klaren, detailarmen Zeichenstil. Taiyōs Matsumotos Charakterdesigns verzichten größtenteils auf Schattierungen, in ihren Haaren flimmern noch die Bleistiftstriche. Negativräume dominieren die Kompositionen – graue Himmel, ausgewaschene Flussbetten. Dadurch erarbeitet der Film sich eine große gestalterische Freiheit. Einer der magischsten Momente ereignet sich, als er das Gehör des blinden Tomona bebildert: Dessen Erfahrungswelt ist weiß, verwischt durch dicke Pinselstriche. In Blutrot werden die Geräuschquellen sichtbar; die Menschen und Objekte, an denen der Schall abprallt, erscheinen als rote Umrisse wie durch ein Echolot aus Ölfarbe. In seiner Gestaltung ist der Film so frei wie in seiner Vermischung historischer Details.

Fiktive Filme stehen natürlich immer vor einer Mammutaufgabe, wenn es darum geht, eine große, weltverändernde Kunst zu behaupten. Dan Gilroys Die Kunst des toten Mannes (Velvet Buzzsaw, 2019) beispielsweise erzählt von den mörderischen Bildern eines wahnsinnigen Künstlergenies. Das größte Problem hier: Die vermeintlich herausragenden Gemälde sind aus objektiver Sicht einfach nicht sehr gut. Yuasa findet in Inu-Oh hingegen einen effektiveren Ansatz, indem er nicht etwas Neues zu erfinden versucht, sondern mit dem Verweis auf den Rock ’n ’ Roll unser kulturelles Vorwissen stimuliert. Die Musik von Otomo Yoshihide ist solider, wenn auch streckenweise zu sauberer Hair-Metal. Getragen wird die Musik dann aber durch die haargenauen Gesangsstimmen von Mirai Moriyama und Avu-chan. Letzterer ist Frontsänger der japanischen Rockband Queen Bee.
Poesie durch Assoziationen

Die spektakulären Auftritte von Inu-Oh und Tomona bilden das Herzstück des Films. Yuasa fängt diese größtenteils auf eine Weise ein, die an echte Konzertmitschnitte erinnert, nämlich in langen, statischen, größtenteils frontalen Einstellungen. Gerade in diesen langen Liedsequenzen regelt der Film aber seine kreative Extravaganz stark zurück. Um hier die Spannung aufrechtzuerhalten, fehlt es den Bildern an Details; die hakeligen Bewegungs-Animationen drehen sich oft in Schleifen. Die Euphorie, die Tomonas und Inu-Ohs Kunst beim Publikum auslöst, wird dadurch eher auf intertextueller, weniger auf sinnlicher Ebene greifbar. Oft springen die Szenen zwischen wenigen Einstellungen hin und her – in zwei unabhängigen Momenten sieht man Männer auf Krücken im Publikum, die spontan in einen Breakdance verfallen. Andererseits jonglieren diese Momente so konsequent mit ihren Zeiten, dass man sie dem Film kaum vorwerfen kann.

Natürlich möchte Inu-Oh keine Realität behaupten, er ist weniger eine runde Erzählung als eine Erzählung über das Wesen von Erzählungen. Handlungen und Motivationen zeichnet der Film nur grob nach und arbeitet im Drehbuch wie im Zeichenstil mit Leerstellen, um eine universelle Geschichte über die Zusammenhänge von Geschichten, Gesellschaft und Macht zu erzählen. Die einen möchten Geschichten beherrschen, um die eigene Erfolgsgier zu stillen. Die anderen wollen sie verbieten, weil in ihnen umstürzlerisches Potenzial steckt. Seine Poesie findet Inu-Oh dadurch auch in seinen Assoziationen, an denen das Kinopublikum mit ihren eigenen Erfahrungen anknüpfen kann. Durch seine Vermischung der Zeiten will Inu-Oh eine Zeitlosigkeit erreichen, trifft damit sogar eine Aussage über die Zeitlosigkeit von Geschichten selbst.
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Trailer zu „Inu-oh“
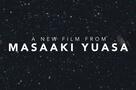
Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (20 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.







