Höllental – Kritik
Marie Wilke beschäftigt sich in der Serie Höllental mit dem bis heute ungeklärten Mord an der neunjährigen Peggy Knobloch. Anders als viele true crime-Formate verzichtet sie auf Spekulation und widmet sich der Aufräumarbeit.

Die Kamera schwebt über den Dingen. Bedächtig folgt ihr Blick von oben einer Straße, die sich durch das Grün des Waldes windet. Dächer ersetzen allmählich die Baumspitzen, die Straße bietet dem Kamerablick mehr und mehr Abzweigungen an, denen er nicht folgen will. Dann ein Platz mit Sitzbänken, eine Art Kreuzung, über der die per Drohne gesteuerte Kamera anhält. Immer wieder ist in Höllental diese Kreuzung in der kleinen oberfränkischen Stadt Lichtenberg am Rande des Frankenwaldes zu sehen. Es ist der Ort, an dem die damals neunjährige Peggy Knobloch 2001 verschwand; ein Areal zwischen Schulbushaltestelle und Elternhaus, wo die Erzählungen um einen der bekanntesten Kriminalfälle der jüngeren deutschen Geschichte ihren Ausgangspunkt nehmen und zusammenfallen. Marie Wilke beschäftigt sich in der sechsteiligen, dokumentarischen true crime-Serie Höllental mit dem Fall Peggy, der bis heute ungelöst ist.
Unbewohnte Bilder

Neben den Drohnenaufnahmen von der Kreuzung, von Lichtenberg und dem Wald, in dem sich jenes titelgebende Höllental befindet, zeigt Wilke in langen Einstellungen die Schauplätze der damaligen Ereignisse. Es sind mediale Erinnerungsarchitekturen: das Haus der Familie mit der himmelblauen Fassade, vor dem die Redaktionen campierten; Peggys Schule und die Turnhalle, in der Mutter Susanne bei einer Pressekonferenz unter Tränen um die Mithilfe der Bevölkerung bat. Menschliche Akteure fehlen in diesen Aufnahmen. Ihre Auftritte verlagert Wilke in anderes filmisches Material, schaltet sie über vergangene Fernsehbilder und Nachrichtensendungen, Fotos und eingescannte Ermittlungsakten hinzu, die Höllental auf spezifische Weise aufbereitet. Denn es ist die ruhige Stimme von Dokumentarfilmer Thomas Heise, die aus dem Off die eingeblendeten Texte der Protokolle vorliest. Diese Vorgehensweise mitsamt Besetzung weckt Assoziationen an Heimat ist ein Raum aus Zeit (2019), in der Heise selbst anhand von Briefen und weiteren Schriftstücken eine episodenhafte Reise durch seine Familiengeschichte anstellte.
Auch in Heimat ist ein Raum aus Zeit sind die Aufnahmen zumeist menschenleer, existiert das Personal jedoch in anderen Medien, lebt in ihnen fort. Die Bilder bleiben unbewohnt. Wilke bedient sich dieser Geste insofern, als sie die Abwesenheit von Menschen als Kommentar für das Medienspektakel nutzt, dem das Rätselraten um Peggys Verbleib gleichkam (und das es mit Wilkes Höllental immer noch bedeutet). Es geht um das blonde Mädchen mit den blauen, wirklich blauen Augen (wie bei Wilke permanent betont wird) als Produkt von Erzählungen. Dazu passt, dass Höllental gleich zu Beginn noch eine Interviewebene etabliert. Dort kriegt die Kamera endlich Menschen vor die Linse. Vorwiegend Journalisten sprechen en détail über die Irrrungen und Wirrungen des Falls. Obgleich auch ein Pressesprecher der Polizei, ehemalige Ermittler, der Bürgermeister und die Bevölkerung der Stadt Lichtenberg zu Wort kommen, entsteht der Eindruck, dass Reporter hier als Experten dienen, dass sie über die Maße analysiert, geschnüffelt, Bücher geschrieben und Nachforschungen angestellt haben. Explizit formuliert Höllental jene Medien- und Gesellschaftskritik kaum. Sie läuft in der gewählten Form mit. „Ganz Deutschland wollte wissen, was mit Peggy passiert ist“, sagt einer von ihnen einmal.
Ein feuchter, deutscher Journalisten-Traum

Im Jahr 2016, also 15 Jahre nach dem Verschwinden, entdeckte ein Pilzsammler in einem Waldstück in der Nähe von Lichtenberg die sterblichen Überreste des Mädchens. Wie sie dorthin gelangten und was tatsächlich auf Peggys Heimweg von der Schule passierte, ist unklar, stehen sich doch diverse Aussagen gegenüber. Massenhaft meldeten sich Zeug*innen im Laufe der Jahre bei der Polizei. Über 6400 Spuren wurden gesichert, 3600 Vernehmungen durchgeführt. Trotz mangelhafter Beweislage wird 2004 der geistig behinderte Ulvi Kulac, den Wilkes Gesprächspartner*innen in Höllental verniedlichend „der Ulvi“ nennen, zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Dabei ist sein Geständnis, das allein zum Urteil geführt hat, unter Druck der Polizei entstanden, die der deutschen Bevölkerung einen Mörder präsentieren wollte – obwohl noch keine Leiche gefunden war. Höllental zeigt Ausschnitte eines Tatrekonstruktionsvideos, in dem Kulac durch Lichtenberg stapft und den Kommissaren bereitwillig Auskunft darüber gibt, wo er Peggy geschubst und erstickt habe.
Die Souveränität, mit der er als möglicher Täter Abläufe nachspielt, ist eindrücklich. Höllental wird sie aber wenig später kassieren, indem Gutachten eingeblendet werden, in denen der Text für diese Performance vorgeschrieben wurde. Ein fiktives Drehbuch, das Kulac von Polizei und psychiatrischer Betreuung eingetrichtert wurde. Es kommt zu einem Wiederaufnahmeverfahren, Kulac wird 2014 freigesprochen. Den peak der Absurdität erreichen der Fall wie Wilkes Serie, als am Fundort der Skelettteile, die von Peggy stammen, DNA-Spuren des Rechtsterroristen Uwe Böhnhardt bemerkt werden. „Sensationeller geht’s ja gar nicht mehr“, kommentieren die befragten Journalisten in Höllental die damalige Entdeckung, der, wie sich herausstellt, ein verunreinigtes Metermaß der Polizei zugrunde liegt. Oder auch: „Da flippste aus“. Die Zusammenführung von NSU-Morden und Peggys Tod: in Höllental ein feuchter, deutscher Journalisten-Traum.
Im Nebel

Es ist angenehm, dass Höllental entgegen anderen true crime-Formaten keine eigenen, tollkühnen Spekulationen anstellt oder reißerisch daherkommt, sondern vielmehr mit Aufräumarbeiten beschäftigt ist. Wilkes Serie ordnet, nüchtern, unaufgeregt, ohne Angst vor der Tatsache, dass der Fall Peggy keine einfachen Lösungen anbietet, an denen sich dramaturgisch festhalten ließe. So vollzieht Höllental im Versuch des Sortierens manchmal eine ähnliche Bewegung wie die Berichterstattung seit 2001, dreht sich, kommt nicht von der Stelle, hält an etwas fest, kehrt zu Orten und Personen zurück. Die atmosphärische Musik von Uwe Bossenz passt zu dieser Bewegungseinschränkung. Es sind lang gehaltene, dunkel-mysteriöse Klänge, die sich wiederholen und mit jedem Ton vergeblich auf Erlösung in der Variation hoffen lassen. Sie begleiten die Landschaftsaufnahmen von Stadt und Wald, ja immer wieder diese Bäume, immer wieder diese eine Kreuzung. Während die Perspektive von oben Übersichtlichkeit verspricht, entzieht sich das inhaltliche Geschehen einer Aufklärung. Im Oktober 2020 wurden die Ermittlungen eingestellt, teilt eine Einblendung am Ende der letzten Folge mit.
Was an Wilkes Serie irritiert, ist die ausbleibende Positionierung zu Dingen, die bei der Sichtung ziemlich offensichtlich mitlaufen: die denkwürdige Konstruktion von Peggy als „Kind aus unserer Mitte“, zu dem sie ein Reporter in einem Nebensatz erklärt; rassistische Fantasien bei der Fahndung, die sich in einem roten Mercedes manifestieren, mit dem das Mädchen über die Grenze nach Tschechien gebracht worden sein soll; die Personalie Wolfgang Geier, der in der Ermittlungskommission Peggy II den Ton angab, gegen den türkischen Stiefvater des Kindes Untersuchungen einleitete und später als Leiter der Besonderen Aufbauorganisation Bosporus in der NSU-Mordserie genau einen rechtsextremistischen Hintergrund der Tat negierte, um jahrelang die Hinterbliebenen der Ermordeten zu verdächtigen; insgesamt die Rolle der Polizei im Fall Peggy, ihre Methoden sowie die Verbindungen zur Politik, die „Druck gemacht“ habe, wie kontinuierlich gesagt wird; die unzähligen Erzählungen von Kindesmissbrauch, die Höllental bei den Recherchen streift; was es bedeutet, dass in dieser Serie vor allem Männer sprechen und dass sie wiederum vor allem über Männer sprechen, die Kinder missbraucht haben. Wilkes Serie nimmt sich zurück, schwebt wie die Kamera an der Drohne über all dem Irdischen, hinterlässt Fragen, wo erst die eigentliche Arbeit anfängt. Höllental ist respektvolle Draufsicht auf einen Kriminalfall als Wald, dessen Baumwipfel der Nebel umspielt.
Die Serie kann man sich in der ZDF-Mediathek ansehen.
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Bilder zu „Höllental“

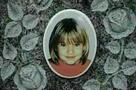


zur Galerie (9 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.








