Havelland Fontane – Kritik
Die Realität kuratieren. Bernhard Sallmanns inzwischen vierter Fontane-Film begibt sich abermals auf eine romantische Wanderung durch die Mark Brandenburg. Im Gepäck hat er politisches Potenzial und einen musealen Audioguide.

Es hat etwas Ironisches, wenn gleich zu Beginn des Films aus dem Off eine Stimme spricht, während man einer hochgewachsenen Birke beim Schaukeln im Wind zuschaut. Es ist eine fast zu literarisch formulierte, in ihrem Informationsgehalt beinah didaktische Sprache, vorgetragen von einer angenehmen Stimme, die in puncto Sound und Inhalt frappierend an Audioguides im Museum erinnert. Man hört Namen wie „Hermann von Katte“, „Paul Jakob von Gundling“ oder „Albrecht der Bär“, Ortsnamen wie „Klüden“, „Petzow oder „Wublitz“, erfährt etwas über das historische Volk der Wenden, über ihren Schlafkomfort in Strohbetten, über ihre Art, Schlangen zu jagen. Mal wird diese Stimme für eine längere Zeit verstummen, nur um dann wieder ganz plötzlich aus dem Nichts zu erklingen und einen wieder kurz schmunzeln zu lassen. Der endgültig ironische Bruch aber wird ausbleiben – seine leichte Sperrigkeit ist dem Film ein durchaus ernstes Anliegen.
Endloser Raum

Havelland Fontane entwickelt sich dabei zu einem Film von genauso schöner Schlichtheit wie sein Titel. Ein Titel, der nebenbei auch ziemlich genau wiedergibt, womit wir es bei Bernhard Sallmanns inzwischen schon viertem Essay über die Wanderungen Theodor Fontanes durch die Mark Brandenburg zu tun haben. Die Audiovisualität besteht zunächst genau aus diesem Paar: gegenwärtigen Bildern der brandenburgischen Mark, ihrer Felder, Wälder, Gebäude, Orte, Nicht-Orte – und eben den Worten Fontanes, die sich, zwischen 1862 und 1889 formuliert, als gelesenes Voice-over darüber legen. Beides zusammen spannt einen riesigen, kaum greifbaren Raum auf. Topografisch liegt er irgendwo zwischen Schloss Sanssouci und Magdeburger Dom, zeitlich irgendwo zwischen elftem Jahrhundert und heute.
Film als romantisches Wandern

Sallmanns Film will diesen Raum aber auch nicht in seiner Gänze zu fassen kriegen, sondern ihn genau wie Fontane bewandern. Im Voice-over schlägt sich das in scheinbar endlosen Sätzen und fast überdetaillierten Beschreibungen noch der banalsten Handlungen und natürlicher Phänomene nieder. Mal geht es etwa um Brandenburger Akazienbäume, aus denen die Flotte des preußischen Reiches gebaut wurden, mal um die Techniken des Schwanenfangs und -rupfens, die sich von Dorf zu Dorf unterschieden. Dann wieder geht es um die Charaktere verschiedener Bevölkerungsgruppen wie der Preußen oder der Lipper oder um Moore, in denen sich eine Grasschicht auf dem Wasser bildet. Literarisches Wandern also: Das ist bei Fontane keine Fortbewegung, um auf dem Weg alles mal gesehen zu haben, sondern eine Entschleunigung, die sich nur bewegt, um punktuell stehen bleiben zu können und länger und genauer zu blicken, als andere das tun. Übersetzt ins Filmische bedeutet das eine strenge Form: keine Schwenks, keine Kamerabewegung. Nur statische, lange Einstellungen, die sich ausschließlich durch abrupte Schnitte durch den Raum navigieren.

Havelland Fontane ist dabei durchaus romantisch. Das liegt schon in den stilistischen Traditionen, die sich hier begegnen: Zum einen eben Fontane mit seinen ausgedehnten, naturverliebten Beschreibungen. Zum anderen aber auch Sallmanns Bilder: In ihrem Aufbau sind sie Reminiszenzen an Caspar David Friedrich – durch den Horizont zweigeteilt; in der unteren Hälfte weite Landschaft, in der oberen Hälfte stets graue Wolkenfront. Romantisierend aber sind sie nicht. Die Himmeldecke entwickelt keine Erhabenheit, die Landschaft ist oft trist. Gerade mit der musealen Stimme wirken sie zusammen oft wie heruntergekommene, längst verlassene Ausstellungsstücke. Wie leicht bewegte Dioramen, die allerlei Details ansammeln, für deren Erschließung man nicht nur die große Leinwand, sondern auch die konzentrierte Atmosphäre des Kinos braucht.
Politisches Kuratieren

Sallmanns Regiearbeit ist dementsprechend das Kuratieren der zahlreichen Motive und ihrer Wirkungen. Man könnte eine ganze Inventarisierung davon vornehmen: Klöster, Kirchen, alte Hütten und Stege sind oft im Vordergrund, modernere Hochhäuser meistens nur in der Ferne zu finden. Es gibt durchaus auch mal die provinzielle Industrie mit ihren Fabriken und dampfenden Türmen, aber viel mehr interessieren ihn heruntergewirtschaftet wirkende Fischerdörfer. Havelland Fontane lässt diese Bilder zueinander kommen, verbindet sie so mit den Texten, dass dazwischen entstehende Bedeutungen die Szenen nicht eng aneinanderkitten, sondern dem Zuschauer zwischen ihnen genug Raum zum Denken lassen.

In dieser Logik bilden vor allem Fortbewegungsmittel den gemeinsamen Nenner vieler Bilder: Fahrräder, Flugzeuge, Helikopter, Schiffe, Segel-, Ruder-, Motorboote. Immer wieder durchkreuzen sie als Vehikel das Bild oder hallen als Fluglärm aus dem Off nach. Wie eine Antithese zum Wanderrhythmus wirkt das, weil sie auf Flugschneisen, Wasserwege, Straßen, eben auf die Notwendigkeit einer schnellen Überbrückung dieser Provinz verweisen. Einmal erzählt der Fontane-Text vom Aufkommen des Bootshandels, in dessen Folge zahlreiche Menschen über die regionalen Flüsse nach Berlin oder Hamburg abfahren. In diesen Momenten offenbart der Film auch das politische Potenzial seines Konzepts. Dass sich dieses in knapp zwei Stunden auch mal abnutzt, scheint ob der strengen Form unvermeidbar. Aber selbst dabei geht es noch auf, weil das widerständige Bleiben eines Blickes akzentuiert wird, der selbst dort noch weiterschaut, wo andere schon wieder mit dem Auto weiterfahren – oder gleich zu Beginn des Films das Kino verlassen.
Neue Kritiken

Hamnet

Die Stimme von Hind Rajab

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika
Trailer zu „Havelland Fontane“
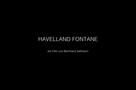
Trailer ansehen (1)
Bilder
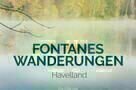



zur Galerie (12 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.










