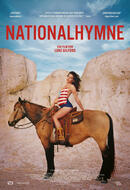Händler der vier Jahreszeiten – Kritik
Ein Mann, ein Markt und die Kehrseite des deutschen Wirtschaftswunders.

Händler der vier Jahreszeiten (1971) speist sich im Wesentlichen aus zwei Motivquellen: zum einen aus der konsequenten Weiterentwicklung von Fassbinders Filmsprache, die dieser in seinem Schlüsselfilm Warnung vor einer heiligen Nutte (1970) – paradoxerweise gerade durch das Infragestellen der Praktiken des Filmgeschäfts – erheblich verfeinern konnte, und zum anderen aus seiner verstärkten Beschäftigung mit den Hollywood-Melodramen des von ihm verehrten Douglas Sirk.
Steht in Warnung vor einer heiligen Nutte noch ein Kollektiv im Mittelpunkt, das im Grunde wie ein aus vielen selbstständigen Figuren zusammengesetzter Protagonist agiert, fokussiert Händler der vier Jahreszeiten ganz den Einzelmenschen. Erzählt wird aus dem Leben des Obsthändlers Hans Epp (Hans Hirschmüller), der in den tristen Münchener Hinterhöfen als Ausschreier seine Waren feilbietet. Pflaumen und Birnen stehen hier sinnbildlich für die süßen Früchte des Erfolgs, der in jenen Jahren des rasanten wirtschaftlichen Aufschwungs vermehrt auch die unteren Gesellschaftsschichten erfasste.

Obschon die Handlung in den 1950er Jahren spielt, ist Händler der vier Jahreszeiten nur vordergründig ein in der Wirtschaftswunderzeit situiertes Drama. Vieles deutet darauf hin, dass Fassbinder die aktuellen gesellschaftlichen Verhältnisse nur in das Gewand der Ära Adenauer hüllte, um seine Kritik an der bundesrepublikanischen Gegenwart einem breiteren Publikum zugänglich zu machen – etwa die leicht übertragbare, im Grunde zeitlose Verfallsgeschichte, die vielerorts unverändert gebliebene Nachkriegsarchitektur oder einige anachronistische, offenbar bewusst „falsch“ platzierte Requisiten. Durch diese zeitliche Versetzung kann das Publikum sein eigenes Spiegelbild als ein fremdes erfahren, was den Film im Gegensatz zum Frühwerk des Regisseurs durchaus massentauglich macht.

Fassbinders nunmehr voll entwickelte, mit viel Sirk’scher Larmoyanz angereicherte Stilistik konterkariert effektvoll die gesellschaftliche Aufbruchsstimmung der wieder erstarkten Bundesrepublik und setzt dieser eine Ästhetik der Verlangsamung entgegen. Irm Hermanns müder Blick, ihre gleichsam nach innen gestülpten Lippenreste, blutleer wie die Versprechungen einer korrumpierten Wohlstandsgesellschaft, oder der hier aalglatt agierende Kurt Raab, der den kraftstrotzenden Karrieremenschen mimt – sie geben dieser Ära ein Gesicht. Indem der Regisseur seine Akteure zuweilen wie Requisiten behandelt, erscheint in dem steifen Arrangement der Schauspieler auch so etwas wie die Biederkeit einer Gesellschaft, die es vor allem auf Scheinproduktion angelegt hat – da muss der Anschein von Stärke stets gewahrt bleiben; nur keine Schwäche zeigen, nichts, was die Nachbarn alarmieren könnte. Insofern wird Fassbinders Stil zum Signet einer nunmehr historischen, doch sichtbar in die Entstehungszeit des Films hineinwirkenden gesellschaftlichen Umbruchsphase.

Den theatralischen, gekünstelten Inszenierungscharakter unterstreicht auch die hermetische Raumsituation. Agierten die Darsteller in den frühen Werken Liebe ist kälter als der Tod (1969) und Katzelmacher (1969) zumeist vor kahlen Wänden, so hat sich die Opazität der Mauern jetzt in die Hinterhofkulisse der Wohnbezirke verlagert. Man erhält gewissermaßen das Raumgefühl einer Guckkastenbühne. Diese Nachkriegsarchitektur ist formal derart reduziert, dass sie selbst schon die Gestalt eines Bühnenbildes annimmt. Sie wird zur Spielstätte für Alltagsdramen. Und in den muffigen Wohnstuben besingt Rocco Granata das Tapetenmuster, Kruzifixe und goldgerahmte Heile-Welt-Veduten. Auch daran geht Hans Epp zugrunde, an der tristen Einfalt dieses Spießertums.
Die vermeintlich intakte kleinbürgerliche Weltordnung kollabiert schon im engsten Familienkreis. Es sind nicht eigentlich die „Großen“, nicht die abstrakten, menschenfeindlichen Behörden, nicht die Tempelstätten bundesrepublikanischer Prosperität, die Hans zermürben, sondern seine Allernächsten: seine Familie, Freunde und Kollegen. Die machen ihn kaputt. Gier, Vorteilsdenken und rücksichtsloses Karrierestreben haben in diesem Nachkriegsdeutschland einen moralischen Kahlschlag angerichtet. Und einer wie Hans, der zwischen Proletariat und Kleinbürgertum unentwegt aufgerieben wird, muss schließlich scheitern, weil er keine Verbündeten hat. Alle hassen ihn, wie seine Schwester Anna (Hanna Schygulla) einmal treffend bemerkt, und tatsächlich: Als er sich zu Tode säuft, greift keiner ein. Hans wird beerdigt, und Harry nimmt spontan seinen Platz ein. Noch über seinen Tod hinaus, so scheint es, muss Hans Epp erfahren, was wie ein Grundprinzip modernen Wirtschaftens anmutet: dass jeder ersetzbar ist.
Neue Kritiken

Monster: Die Geschichte von Ed Gein

Dracula - Die Auferstehung

Frankenstein

Danke für nichts
Trailer zu „Händler der vier Jahreszeiten“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (12 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.