Gandahar – Kritik
Der von der Comicwelt inspirierte psychedelische Science-Fiction-Film Gandahar (1987) ist eine eigenwillige Erfahrung und eine Augenweide. Die bedeutungsschwere Geschichte um den von einer faschistischen Macht angegriffenen Planeten dient René Laloux aber wohl vor allem dazu, die vielen Brüste zu legitimieren.

René Laloux’ dritter und letzter abendfüllender Spielfilm Gandahar stammt aus dem Jahr 1987. Seine Geschichte beginnt aber deutlich früher. So wurde die Vorlage, der Sci-Fi-Roman Les hommes-machines contre Gandahar von Jean-Pierre Andrevon bereits 1969 veröffentlicht. Der Stil ist zudem tief verwurzelt in einer franko-belgischen Comicszene, die in der Gegenkultur der 1960er Jahre sowie im Magazin Pilote keimte und die in den 1970er Jahren in Veröffentlichungen wie Métal hurlant aufging. Psychedelic, Science-Fiction, Sex sowie die Abkehr von der Realität/Gesellschaft waren die tragenden Säulen von Autoren und Zeichnern wie Mœbius, Jacques Lob oder Caza. René Laloux, dessen Karriere als Mitarbeiter einer Psychiatrie begann, hatte mit Mœbius den Film Herrscher der Zeit (Les Maîtres du temps, 1982) realisiert, und mit Caza arbeitete er nun 1987 eng an der Erstellung des Looks von Gandahar zusammen.
Äußere Feinde, innere Probleme

Der Einfluss dieser Welt der Comics ist dem Film deutlich anzusehen. Die Hauptstadt des titelgebenden Planeten ist ein riesiger Kopf, der oben an einem Berghang sitzt. Die Landschaft ist so surreal wie die Mutanten, auf die wir im Laufe der Geschichte treffen. Diese haben Augen als Hände, ihnen wächst ein zweiter Unterleib aus der Brust oder sie tragen einen weiteren Kopf auf Stirn oder Kinn. Traumlogik trifft auf Exotik trifft auf den Willen, nicht allzu viel Steine aufeinander stehen zu lassen. Gandahar ist wie alle Filme von Laloux eine Augenweide und lädt dazu ein, sich einer eigenen und eigenwilligen Erfahrung hinzugeben.
Die Geschichte eines friedlichen Planeten, der von einer faschistischen Macht – amüsante Randnotiz: die Animation wurde nach Nordkorea outgesourced – angegriffen wird, ist auch zu jeder Zeit als Kind des vorherigen Jahrzehnts erkennbar. Als die gezüchteten Überwachungsvögel von einem Ort keine Nachrichten mehr übermitteln, wird Kundschafter Sylvain losgeschickt, aufzuklären, was sich zuträgt. Was er findet, wird aber nicht nur einen äußeren Feind offenbaren, sondern auch innere Probleme deutlich machen. Eine Armee von schwarzen, metallenen Soldaten kommt aus der Zukunft, versteinert die Bevölkerung des Planeten Gandahar und verwandelt sie wiederum in ferngesteuerte Soldaten aus Metall. Die Ursache findet sich aber nicht an fernen Orten, sondern in der eigenen Vergangenheit, in Genexperimenten, die verantwortungslos entsorgt wurden.
Begrenzte Subversion
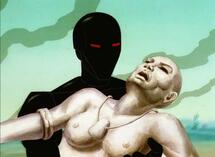
Das zerstörte Vertrauen in den Status quo des Westens ließen Andrevons und Laloux in eine Geschichte fließen, in der eine utopische Gesellschaft einer faschistischen Invasion ausgesetzt wird und in der sich diese darüber hinaus als skrupelloses, ausbeuterisches System offenbart, das sich einen Dreck darum kümmert, was außerhalb ihres Paradieses passiert und wer unter ihrem Wohlstand leidet. Dieses zweischneidige Schwert wird noch um tausendjährige Zeitreisen erweitert, und um einen Zeitbegriff, der einer Möbiusschleife ähnelt. Wie es im mythischen Leitspruch des Films heißt: „In tausend Jahren wurde Gandahar zerstört und all seine Bewohner massakriert. Vor tausend Jahren wird Gandahar gerettet werden und was nicht verhindert werden kann, wird sein.“
Unsicher- und Fremdheit bestimmen Gandahar also, und bei einem so auf Subversion ausgelegten Konzept darf der Sex selbstredend nicht fehlen. Er tritt in schelmischen Details in Erscheinung – Teile von landschaftlichen Formationen oder Gebäude ähneln des Öfteren männlichen und weiblichen Geschlechtsmerkmalen – oder darin, dass die Frauen von Gandahar grundsätzlich barbusig bleiben. Und das Problem des Films wird genau in diesem etwas begrenzten Begriff von Erotik und Subversion deutlich. Denn mehr als kleine Streiche und Brüste gibt es in der Richtung nicht. Die „zentrale“ weibliche Figur bleibt eine Cheerleaderin der Hauptfigur, die auch schnell aus dem Film verschwindet, sobald sie gerettet ist und Sylvain zum Kern der Probleme vordringt. Es bleibt beim biederen Ausleben eines Fetischs.
Mit Bedeutsamkeit belagert

Ebenso verhält es sich mit den psychedelischen Momenten der Geschichte. Sie schaffen es kaum, über minimale erste Eindrücke hinaus waghalsig zu wirken, bleiben letztlich genauso eindimensional, oberflächlich und lustlos wie die Erotik. Jeder wirkliche Schatten, der hätte heraufbeschwört werden können, bleibt ungenutztes Potential in einem unengagierten Hin und Her. Stattdessen werden einfach alle Menschen, die so hohl bleiben wie die Roboter, unmotiviert Brüder. Und die Welt bleibt eine dünne Gardine, hinter der nichts steckt. Ein paar schöne Eindrücke hält der Film bereit, mit jeder Minute wird aber schmerzlich deutlich, wie schemenhaft und limitiert die dahinterstehende Vorstellungskraft ist.
Während jedoch viel Tamtam um die dünne, sich ziehende Geschichte und die Welt Gandahars gemacht wird, ohne dass sich angestrengt würde, etwas aus den Potenzialen herauszuholen, bleibt der stetige Strom aus Brüsten wie nebenher bestehen. Und so wirkt es schnell, als sollten thematisches Gewicht und vermeintliche Qualität das Vorhandensein der prallen Busen legitimieren. Und damit steht der Film dann doch im krassen Gegensatz zum optisch und kulturell nicht unähnlich gelagerten US-Zeichentrickfilm Feuer und Eis (Fire and Ice, 1983), einem Sword-and-Sorcery-Film, der wenig Aufhebens darum macht, um welche niederen Vorlieben es ihm geht. Der aber auch ungleich sympathischer ist, weil er uns nicht mit seiner Bedeutsamkeit belagert und weil er sich an Pete Townsends Leitspruch hält: „If you steer clear of quality, you’re alright.“
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Trailer zu „Gandahar“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (9 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.








