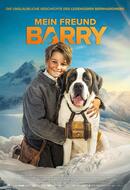Flow – Kritik
Gints Zilbalodis setzt, aus der Perspektive einer jungen Katze und ohne Worte, einen Weltuntergang in Szene. Die wahren Gefahren lauern im Oscar-prämierten Animationsfilm Flow jedoch nicht in reißenden Wassermassen, sondern in der Unlesbarkeit des Anderen.

Die eigentliche Katastrophe verläuft sanft, wie eine Umarmung. Zwar gab es zunächst einen kurzen Moment stürmischen Aufruhrs, eine mächtige Wasserwalze fegte durch die Landschaft, riss Bäume aus und wirbelte viele tierische Waldbewohner mit sich fort; aber dieser Einbruch ging vorüber und danach schien wieder Ruhe eingekehrt zu sein. Nun aber steigt der Pegel der Bäche und Rinnsale immer weiter an, so gemächlich wie beharrlich. Zentimeter um Zentimeter verschwinden Wiesen, Felsen und schließlich auch massive Gebirgszüge unter der freundlich glitzernden Oberfläche des zunehmend allumfassenden Wassers. Gints Zilbalodis setzt den Weltuntergang in seinem Oscar-prämierten Animationsfilm Flow nicht als brutale Auslöschung in Szene, sondern als eine feierliche Umwälzung, die etwas Schönes, Majestätisches, in einem kosmischen Sinn vielleicht auch etwas Gutes hat.
Arche ohne Noah

Trotz aller Schönheit ist diese Umwälzung für jene, die sie durchleben, eine existenzielle Bedrohung. Zilbalodis’ wortloser Film ist ganz aus der Perspektive einer jungen Katze erzählt, die ums Überleben kämpfen muss. Im letzten Moment kann sie sich vor den alles verschluckenden Wassermassen auf ein vor sich hin treibendes Segelboot retten. Dort finden auch weitere Tiere Zuflucht: ein Lemur, ein Golden Retriever, ein Sekretärsvogel und ein Wasserschwein. Gemeinsam versucht diese ungleiche Gruppe die Gefahren der so grundlegend verwandelten Welt zu navigieren. Wie einem lautlosen Ruf folgend, steuern die Tiere ihr Boot auf einen in weiter Ferne am Horizont aufragenden, geheimnisvollen Monolithen zu.

Menschen scheint es in dieser Welt schon lange nicht mehr zu geben. Zwar ist die Landschaft übersät von den Spuren einer früheren menschlichen Besiedelung – leere Holzhütten, massive Steinstatuen, eine riesige Stadt vorindustrieller Prägung. Doch all diese Stätten sind, deutlich erkennbar, schon seit geraumer Zeit unbewohnt und der Verfall, der sich ihrer bemächtigte, hatte augenscheinlich schon lange vor der jetzigen Wasserflut eingesetzt. Die Apokalypse, der wir in Flow beiwohnen, ist also wahrscheinlich nicht die erste, die diese Welt heimsucht, scheinbar bäumt sich die Natur hier immer wieder auf, um sich ihr Recht zu verschaffen. Es sind die unpersönlichen Rhythmen des Planeten, die in dieser Welt den Takt angeben und denen die auf ihm hausenden Lebewesen nichts entgegenzusetzen haben – eine Tatsache, die auch die junge Katze an ihrem eigenen, zerbrechlichen Leib erfahren muss.
Von den Naturkräften hin und her gerissen

Das unermesslich Große der Welt und das machtlos Kleine des individuellen Erlebens – diese klassische Gegenüberstellung bestimmt nicht nur die Erzählung von Flow, sondern auch dessen visuelle Dynamik. Der Bildausschnitt ist unruhig schwankend, wie von einer Handkamera gefilmt, und nimmt stets den aus der Tiefe empor gerichteten Blickwinkel der Katze ein. Schon eine ruhige Wiesenlandschaft wirkt bedrohlich, da die Umgebung sich bis an den oberen Rand des Blickfelds erhebt. Vor allem aber folgen die Veränderungen des Bildausschnitts stets den unsicheren Bewegungen der Katze, so wie sie wird auch das Bild von den äußeren Naturkräften hin und her gerissen, anstatt die Ereignisse aus stabiler Position einzufangen. In einer langen, ungebrochenen Einstellung werden wir etwa zusammen mit der Katze hinab in das schummrige Grün des Wassers gezogen, werden mit ihr von einem mächtigen Wal wieder an die Oberfläche gehoben und dann umgehend in den Krallen eines Vogels hoch in die Lüfte getragen. Diese unablässige Kinetik ist nicht nur körperlich mitreißend, sondern sie macht die Welt des Films auch als etwas Räumliches erfahrbar: Die Welt besteht nicht nur aus einzelnen Orten, sondern auch aus den Entfernungen zwischen ihnen – und diese Entfernungen müssen durchmessen und durchquert werden, sei es freiwillig oder unfreiwillig.

Was nicht heißt, dass der malerische Eindruck in Flow keine Rolle spielen würde. Mit großer Sorgfalt entwirft der Film eine Reihe atemberaubender Lokalitäten, von dichten, sonnendurchschienenen Wäldern über eine märchenhaft opulente, halb im Wasser versunkene Stadt bis zur stürmisch auf und ab wogenden hohen See. Die Landschaften sind stets in dramatisches Licht getaucht und oft sieht man die tierischen Figuren als staunend verharrende Silhouetten im Vordergrund, als bräuchten sie selbst ein paar Augenblicke, um den überwältigenden Anblick in sich aufzunehmen. Vielleicht greifen in manchen Szenen die verschiedenen bildlichen Motive und Stimmungen ein wenig zu nahtlos ineinander, vielleicht schlingen sich manchmal die Lianen ein wenig zu arrangiert um eine zerfallende Ruine. Doch der Film kippt nie ins rein Pittoreske, sein Staunen wird nie zur leeren Geste. Stets scheinen ihm neue Details einzufallen, die er seinen Bilderwelten hinzufügen kann, und stets scheint er sich aufs Neue an diesen Details und an den eigenen bildgeberischen Möglichkeiten zu erfreuen.
Auf selbstlose Opferbereitschaft folgt gehässiger Streit

Abseits der großen kosmischen Vorgänge und der dramatischen Landschaftspanoramen entspinnt sich in Flow außerdem ein intimeres, aber darum nicht weniger drängendes Drama. Denn die junge Katze kämpft nicht nur ums nackte Überleben, sondern auch um eine gelingende Kommunikation mit den anderen Schutzsuchenden, die sie auf ihrer Reise begleiten. Die Tiere versuchen, sich mit Gesten und Blicken untereinander verständlich zu machen und doch scheint es dabei nie zu gelingen, einen stabilen Zugang zum Innenleben des Gegenübers herzustellen. Auf Momente des plötzlichen Verstehens und der wechselseitigen Lesbarkeit folgen unweigerlich Momente der ebenso plötzlichen Fremdheit und Unberechenbarkeit, auf selbstlose Opferbereitschaft folgt gehässiger Streit. Selbst in einer Extremsituation, in der man existenziell auf den anderen angewiesen ist, bleibt ein verlässliches Gefühl der Gemeinschaft unerreichbar.

Immer wieder kehrt Flow zurück zu dem Motiv des Blicks in das eigene Spiegelbild. Wir treffen die junge Katze zu Beginn des Films, als sie ihr eigenes Antlitz in der klaren Oberfläche eines Baches betrachtet. Später wiederholt sich dieser Blick in das reflektierende Wasser, diesmal ist die Katze umrahmt von ihren Reisegefährten. Eine beglückende Erfahrung von Zusammengehörigkeit, könnte man meinen, doch ist gerade in diesem Motiv das Trennende wirksam. Denn der Blick in den Spiegel hat immer etwas Isolierendes, man blickt im Spiegel unweigerlich nur auf sich – weil man selbst das Einzige ist, was der Spiegel einem sichtbar macht, das Einzige, was einem sonst verborgen bliebe. Die Welt mag in Flow in endlosen Wassermassen versinken, aber am Ende liegt die wahre Bedrohung in der Zerbrechlichkeit der Beziehung zu jenen, die einem am nächsten sind.
Neue Kritiken

No Bears

Scarlet

Marty Supreme

Father Mother Sister Brother
Trailer zu „Flow“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (16 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.