Fever Room – Kritik
Und noch ein Screen, und noch ein Screen: Apichatpong Weerasethakuls „Film-Installation“ Fever Room in der Berliner Volksbühne hält den Zuschauer klein und macht sensibel für feine Unterschiede. Das Kopfweh wird gern in Kauf genommen.

Der erste Teil von Apichatpong Weerasethakuls „Film-Installation“ Fever Room – ob man den vom thailändischen Regisseur scheinbar selbst lancierten Theater-Begriff hier wirklich braucht, kann man mindestens bezweifeln – ist betont analytisch. Gleichzeitig lässt er das eben noch unsicher durch einen Seitengang und durchs Dunkel auf die Bühne der Volksbühne tapsende Publikum an Sicherheit zurückgewinnen. Drei bestuhlte Reihen geben die Positionierung vor, der Großteil der Zuschauer hockt auf Sitzkissen davor. Ein Screen und ein dazugehöriger Projektor schweben langsam von der hohen Decke herunter und finden sich frontal zentriert ein. Kino-Dispositiv.
Kopfweh mit Genuss
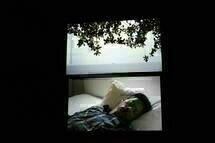
Bild und Ton im Modus des Zeigens und Beschreibens. In zwei sehr ähnlichen, aber nicht identischen Durchgängen sehen wir Alltags-Szenerien, Menschen, Tiere, ein Gemälde mit Menschen und Tieren, dazu kurze Benennungen aus dem Off, zuerst von einer weiblichen, dann von einer männlichen Stimme. Dann ein Übergang, vom Land geht es aufs Wasser, eine Flussüberfahrt und ein zweiter Screen, der ins Spiel kommt bzw. wieder von oben herunterschwebt und knapp über dem ersten zum Halt kommt. Noch eine Bootsfahrt, zwei junge Männer am Bug. Die gleiche Bootsfahrt wie unten, nur aus anderer Perspektive? Oder doch zwei verschiedene Boote, Flüsse, Fahrten? Der Fokus liegt nicht mehr auf dem, was sich bewegt, sondern wie es sich bewegt. Fever Room macht sensibel für die kleinen Unterschiede: Unten schaukelt die Kamera ganz leicht mit, oben verweilt sie fester am Horizont. Dann wird der Unterschied in der Bewegung deutlicher, ein Blick bleibt in Fahrtrichtung ausgerichtet, der andere nimmt das vorbeiziehende Festland ins Visier. Das genießerisch in Kauf genommene leichte Kopfweh stärkt die Erinnerung an Godards Adieu au Langage (2014) zusätzlich.
Vier Leinwände machen einen Fever Room

Ein starker Bass lässt rhythmisch den Boden vibrieren. Ein bulliger Elektro-Sound frisst plötzlich und unverhofft alles Naturalistische aus dem Bild, versklavt es für einige Minuten zugunsten einer Spannungsdramaturgie. Die ruhige Flussfahrt befällt kurzzeitig etwas Monströses, zwei Männer am Ufer scheinen das Boot zu verfolgen. Der Sound ist unheimlich druckvoll, nimmt den ganzen, extrem hohen Vorführraum mühelos ein. Dann verschwindet er wieder, die weiter auf Surround laufende Atmo hält den Zuschauer aber weiterhin klein. Zurück zum Stimmengewirr auf dem Boot, das auf beiden Leinwänden angekommen ist. Vergeblich sucht man nach Dopplungen, nach Menschen und Taschen, die auf beiden Leinwänden zu sehen sind. Die Aufspaltung ist definitiv eine der Zeit, vielleicht auch eine des Ortes. Sie wird noch einmal verkompliziert, zwei weitere Screens erscheinen rechts und links des Publikums. Der Vorführraum ist nun wirklich ausgemessen, die Augen springen noch ein wenig mehr hin und her. Leichte Wellen am Strand, Dschungelpflanzen verdoppelt, links wie rechts das gleiche Bild, während sich die mittigen Bilder harmonischer aneinander ausrichten. Es geht in eine Höhle, die vier Leinwände illusionieren nun einen Raum, wenn auch einen sehr dunklen. Beruhigung. Und immer wieder das Spiel mit natürlichem und künstlichem Licht, Feuer und Lampe. Draußen – Fever Room macht innen und außen auf all seinen Ebenen doch zu recht relativen Setzungen—, irgendwo da draußen also zieht ein heftiger Regenschauer auf.
Die Schwierigkeit, im Alter zu träumen

Die Screens steigen gemeinsam in die Höhe, die Projektoren laufen weiter, das Live-Action-Bild wird einem regelrecht entwendet. Der zweite Akt, Vorhang auf! Viel ist nicht zu sehen, eine flackernde Straßenlaterne stellt den Bezug zu den letzten eben gesehenen Bildern her. Dunkelheit und ein Haufen Nebel, ich realisiere lange nicht, dass wir nun in den eigentlichen Zuschauerraum hineinschauen. Der laut tönende Regen paart sich mit einem Lichtpunkt-Schauer, bevor das im wabernden Dunst liegende Große Haus der Volksbühne vom Hauptprojektor am anderen Ende durchleuchtet und in Form gebracht wird. Der Nebel und das Publikum auf der Bühne sind nun die Screens, aber gleichzeitig auch nicht, funktioniert die Dramaturgie der Lightshow doch gerade vor allem umgekehrt. Was nämlich folgt, ist eine Art erweiterte Überwältigungs-Version von Anthony McCalls Line Describing a Cone. Ein riesiger Zylinder baut sich auf, auf das Quadratische folgt das Runde, der Punkt. Man wird angefallen und fallen gelassen, weggeblasen (immer noch viel Sound) und angesogen, adressiert und verloren. Man wird geblendet und will trotzdem ins Licht gucken. Ein Epilog sinniert über die Schwierigkeit, im Alter zu träumen. Beim Hinausgehen sprechen zwei Frauen von der Symbolik des Lichts am Ende des Tunnels. Mir fällt es schwer, über so etwas Unkonkretes nachzudenken.
Fever Room läuft Ende Januar nochmal in der Volksbühne: https://www.volksbuehne.berlin/de/programm/649/fever-room
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Bilder zu „Fever Room“




zur Galerie (5 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.













