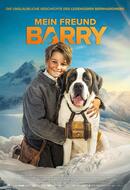Electric Child – Kritik
Um sein sterbendes Kind zu retten, entwickelt ein IT-Wissenschaftler eine künstliche Intelligenz, die bald die gesellschaftliche Ordnung bedroht. Simon Jacquemets philosophisches Sci-Fi-Drama Electric Child stellt große moralische Fragen und bleibt dabei doch nüchtern.

Das mit der KI ist kompliziert. Einerseits soll sie ein fehleranfälliger Zögling kluger Tech-Ingenieur*innen sein, andererseits ein Überwesen, das den Menschen bald abschaffen wird. In jedem Fall werden auf das ewig lernende System fleißig Wünsche und Ängste projiziert. Nur das Kino zögert: Zeitgenössische Filme zum Thema KI sind rar, sieht man etwa von Alex Garlands populärem Ex Machina (2015) ab, der noch dazu weit vor ChatGPT erschienen ist. Sci-Fi-Horror wie M3GAN (2022) und sein kürzlich erschienener Nachfolger M3GAN 2.0. (2025) belustigten Trashfans, regen aber kaum zum Nachdenken an. Das könnte sich mit dem philosophischen Sci-Fi-Drama Electric Child des Schweizer Regisseurs Simon Jacquemet (Chrieg, Der Unschuldige) nun ändern.
Zürich in der nahen Zukunft: Akiko (Rila Fukushima) und Sonny (Elliott Crosset Hove) sind verzweifelt. Ihr frischgeborener Sohn wird laut ärztlicher Diagnose nicht mehr lange leben. Grund ist eine seltene degenerative Nervenkrankheit. Sonny, ein gefragter IT-Wissenschaftler, hofft, sein Kind mithilfe einer künstlichen Intelligenz zu retten. Diese aber entwickelt sich mit Sonnys Zutun so rasant weiter, dass sie bald die gesellschaftliche Ordnung bedroht. Ist das die Rettung eines Kindes wert?
KI im Überlebenskampf

Seit einigen Jahren beobachtet Simon Jacquemet, selbst Vater zweier Söhne, die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz, deren Transformation hin zu einer allgemeinen Künstlichen Intelligenz (AGI) laut Fachleuten bald gelingen kann. Die Frage, die sich daran anschließt, ist was geschehen wird, wenn die weitere Entwicklung zu einer sogenannten hyperintelligenten KI führen sollte: wenn die KI also klüger als der Mensch wird und autonom zu Lösungen gelangt, die für die menschliche Intelligenz noch ungreifbar sind. „Die daraus resultierenden Fragen sind ebenso beängstigend wie faszinierend“, so der Regisseur in seinem Presse-Statement, „wie kann das Überleben der Menschheit in der Koexistenz mit einer hyperintelligenten KI gesichert werden?“
Hyperintelligent wirkt die KI im Film zunächst nicht. Sie wird − in der Gamification eines Lernprozesses, der an William Goldings berühmten Roman Lord of the Flies (1954) erinnert − durch einen nackten Jungen verkörpert, der in der Simulation einer menschenleeren tropischen Insel um sein Überleben kämpft. Ein „evolutionärer Wettbewerb“ soll das laut Sonny sein. Die KI solle wie der Mensch an Herausforderungen wachsen und selbstständig zu Lösungen finden. Doch der KI-Junge rennt bloß ziellos über eine Wiese, fällt in einer unwirklichen CGI-Animation von einer Klippe und stirbt. In einem späteren Versuch schießt die ständig wiedergeborene KI mit einem Maschinengewehr willkürlich in die Büsche. Erst als Sonny proaktiv in das Survivalprogramm eingreift, entwickelt sich die Intelligenz wesentlich weiter.

So konturlos wie die KI wirkt auch Sonny selbst. Ausdruckslos bewegt er sich durch die ozeanblau leuchtenden Serverräume seiner IT-Firma. Wie in David Cronenbergs letztem Film The Shrouds (2024) spiegeln die Menschen die sterile Technologie, statt mit ihr emotionale Krisen zu bewältigen. Dem Geschlechterstereotyp entsprechend ist Sonnys Frau Akiko die einzige Person, die Gefühle zeigt, schreit und weint. Die gemeinsame Wohnung wird von ihr zur technologiefreien Zone erklärt: Handys müssen vor der Tür abgegeben werden, innen ist alles mit bunten Farben und Pflanzen dekoriert. Ein psychedelischer, ursprünglicher Raum, in dem jene Emotionen sein dürfen, die in diesem Science-Fiction-Drama an vielen Punkten fehlen.
Ratlose Menschen
Was keine Kritik am Film darstellt. Im Gegenteil: Die Nüchternheit von Electric Child, der stets sauber ausgeleuchtet und nur von hallenden Ambient-Sounds begleitet ist, schafft ein subtil irritierendes und gerade deshalb faszinierendes Zukunftsszenario. Sofort ist klar, dass wir einer Gesellschaft beiwohnen, die sich schon vor der Übernahme durch eine Hyperintelligenz in einem Schwebezustand befindet. Der abgegriffene Plot um die moralische Frage, ob die Rettung eines einzelnen Kinderlebens die Gefährdung einer ganzen Gesellschaft rechtfertigt, tritt dabei – vielleicht auch unfreiwillig – in den Hintergrund. Im Gedächtnis bleiben dagegen die flackernden Serverräume, die maskenhaften Gesichter und die geisterhafte Atmosphäre.

Unglaubwürdig wird Electric Child nur dann, wenn aus dem Kammerspiel plötzlich ein apokalyptischer Thriller werden soll, mitsamt Explosionen, CGI-Helikopterstunt und dramatischem Showdown. Simon Jacquemets Drama funktioniert aber nicht als Genrefilm, sondern als nachdenkliches Stimmungsbild einer Gesellschaft, die angesichts einer diffusen Hyper-KI mehr Fragezeichen vor Augen als Lösungen zur Hand hat. Mit dieser Darstellung trifft der zurückgenommene Film den konfusen Zeitgeist besser als jeder thesenstarke Blockbuster. Was schon mal ein Anfang ist.
Neue Kritiken

No Bears

Scarlet

Marty Supreme

Father Mother Sister Brother
Trailer zu „Electric Child“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (9 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.