Eisenstein in Guanajuato – Kritik
Museal, digital, scheißegal: Peter Greenaway nutzt das lustvolle Reenactment einer Episode im Leben eines Kinoschöpfers zu einer Erneuerung seiner Frage nach dem Kino selbst.

Eisenstein muss zunächst ein Körper werden im figurenresistenten Kino von Peter Greenaway, deshalb muss er sich gleich mal ausziehen. Nacktheit ist wichtig für Greenaway, weil erst sie aus dem behaupteten Körper einen zumindest annähernd physischen macht. Da steht er also, der Erfinder des Kinos (wenn man Greenaway in dieser Würdigung folgen mag), und redet mit seinem Schwanz. Der antwortet zwar nicht, aber gefilmt ist der Dialog ganz klassisch, quasi im Schuss-Runterschuss. Auf den ersten Blick nicht gerade eine respektvolle Annäherung an einen großen Künstler, andererseits: Woher wissen, was wem Respekt abverlangt? Eisenstein ist jetzt eine Greenaway-Skulptur, geformt aus der Masse des finnischen Schauspielers Elmer Bäck, zugleich monumental und vulgär, denn Greenaways Skulpturen sind nicht nur sprechende, sondern auch kotzende, fickende Skulpturen.
Installation und Montage

Der nackte Eisenstein, der mit seinem Schwanz redet, findet keine verbürgte fotorealistische Entsprechung, wie Greenaway sie an anderen Momenten zuschaltet. Dann drittelt sich der Cinemascope-Rahmen, und historische Aufnahmen rasen in die äußeren Splits des Screens, erlauben den Abgleich zwischen der in der zentrierten Fiktion gerade reinszenierten Person und ihrer Vorlage in der Wirklichkeit. Ein freilich absurder Abgleich, eher Kritik am Biopic und seiner Behauptung eines historischen Realismus. Die öffentlich-rechtliche „Doku danach“ ist direkt in den Film geschnitten, und mit dieser mitgelieferten Gegenüberstellung kommt Greenaway jeglicher gedachten zuvor, zerschneidet direkt das bedrohliche Band, das von diesen ersten Bildern seines Films hinführen könnte zu einer gedachten Psyche, zu historischer Genauigkeit, ja überhaupt zu einer Figur und einer Erzählung. Sprechende Skulpturen, denen jedes menschliche Verhalten erlaubt ist, die aber keine Platzhalter echter Menschen sind.

Nicht nur weg von der Psychologie, nicht nur weg von der Narration. Auch alle Räume, die zu realistischen Settings zu werden drohen – mexikanische Restaurants, das Tunnelsystem Guanajuatos, das luxuriös ausgestattete Hotelzimmer –, werden filmisch verfremdet, sodass sie sich auf möglichst kein Außen mehr beziehen. Kraft und Last des Artifiziellen: Tiefe ist höchstens eine Abfolge von Schichten, niemals eine Möglichkeit, aus dem Bild zu fliehen, das total ist. Die Eisenstein’sche Montage ist Greenaway in seinem Projekt eines Scheuklappen-Kinos, das Fotografie und Literatur rechts und links liegen lässt, ein dankbarer Komplize. Wenn Eisenstein zu Beginn mit seinem Schwanz redet, dann ist die Dusche Teil eines ganz dem Greenaway-Kino entsprungenen tableau vivant; in einer späteren Szene wird sie dagegen in ihre Einzelteile zerlegt, in ein paar Handgriffe und warmes Wasser. Worum es geht in einem bestimmten Moment von Eisenstein in Guanajuato, sei es ein Ereignis, eine Idee, eine Situation, ist entweder eine Installation im Inneren des Bildes und wird von der Kamera umschlichen, oder es wird zusammenmontiert.
Leben und Sterben in Mexiko

Sex und Tod, das ist der Kern von Eisenstein in Guanajuato. Das Substrat des Films – Eisensteins Aufenthalt in Mexiko, nachdem er in den USA kein Filmprojekt zustande bringen konnte – liefert Greenaway eine ganze Menge Stoff für sein Spekulieren, sein Fabulieren über die „zehn Tage, die Eisenstein erschütterten“. Dessen Begeisterung für Mexiko, seine spontane Faszination für aztekische und mexikanische Kultur und Geschichte, die ihn zu seinem gescheiterten Film inspirierten, imaginiert Greenaway als eine sexuelle Erweckung. In einer zentralen Sequenz zur Mitte des Films verliert der 33-jährige Sergei seine Unschuld. Nach einer köstlichen Feier schlüpfrig-mehrdeutiger Dialoge nimmt ihn sein „Guanajuato Guide“ Palomino (Luis Alberti) von hinten, erzählt ihm dabei etwas vom Verhältnis Mexikos zu Europa, von alter und neuer Welt, von der neuen Welt, die sich nun der alten bemächtigt. Expliziter, symbolgesättigter schwuler Sex, der mit einem roten Fähnchen – Deko der vorangegangen Feier zum Jahrestag der Russischen Revolution – in Eisensteins Po endet. Was sich Greenaway hier aneignet, und das ist durchaus erfrischend, ist weniger die filmische Methode des russischen Meisters als seine leidenschaftliche und kompromisslose Instrumentalisierung des Kinos für politische Zwecke. „Homosexuelle Propaganda“ mal ganz ernst genommen und ziemlich in your face.

Bei seiner späteren Abreise erklärt sich Eisenstein zum Toten, verspricht aber, den Himmel möglichst schnell wieder zu verlassen. Man wird Eisenstein aus Guanajuato bekommen, aber Guanajuato nicht mehr aus Eisenstein. Der künstlerische Tod, er kommt als nüchterne, ökonomische Bestandsaufnahme, als aktualisierter Budgetplan: Eisensteins gefilmtes Material trägt nicht, sein Aufenthalt wird nicht verlängert, er muss zurückkehren. Greenaway nutzt diese verbürgte Tatsache für einen Seitenhieb aufs aktuelle Filmgeschäft, zugleich aber, und auch das ist durchaus überraschend, zeigt er im Angesicht des Todes dann fast ein bisschen Herz. Vielleicht wird er auch dazu gezwungen. Jedenfalls strömt auf einmal nicht nur die einen bestimmten Moment konsumierende Lust, sondern auch ein über den Moment hinausweisendes Begehren ins sonst so streng intellektuelle Kino, das nun gezwungen wird, ein schwules Melodram zumindest noch anzudeuten. Da vollführen die beiden sich nun irgendwie liebenden Protagonisten zwei Gesten, die über das das Projekt ihres Schöpfers schüchtern hinausweisen, widerstehen ihrer Integration ins autonome Kunstwerk. Als wären sie doch lieber Figuren denn sprechende Skulpturen; als würden sie Greenaway aus dem Bild heraus vorwerfen, ihre Sehnsüchte hergeben zu müssen, für das bisschen Kunst.
Schlag ins Gesicht
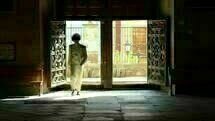
Das bisschen Kunst ist im Übrigen ein ziemlich grandioses filmisches Ereignis, eine Farbenpracht, eine Assoziationswucht, die ein zweites Ansehen nötig macht, zugleich ein Raum, in dem das Museale und das Digitale – jene zwei Nischen also, in die sich das Kino heute angeblich zurückzieht, um in Ruhe zu sterben oder zumindest in einen Winterschlaf zu verfallen – gemeinsam Party machen.
Vielleicht hätte wenig Besseres passieren können, als dass sich dieser filmskeptische Regisseur einmal selbst einem Filmkünstler widmet. Das vitalisiert Greenaways Kino, injiziert ihm neue Formen der Bewegung, allen voran Eisensteins assoziative Montage. Die Redundanzen sind jedenfalls verschwunden, oder besser: Sie sind von reflexiven Spielereien zu Intensitäten geworden, filmische Ritornelle in einem trotz allem Pfeifen auf Narration stetig nach vorne treibenden Film. Zugleich erlaubt Eisenstein in Guanajuato in seiner ganzen mitreißenden Multimedialität den Gedanken, dass Greenaways Kritik an den „abgefilmten Texten“, die ein großer Teil des Filmerbes für ihn darstellt, dass sein Aufruf, den Film als Kunstform durchzusetzen, die weder anderen Künsten noch der Realität Rechenschaft schuldig ist, keine alte Leier mehr ist, sondern in digitalisierten Zeiten noch höchst aktuell werden könnte. Ob man Greenaways Diagnosen nun richtig oder problematisch, produktiv oder arrogant findet: Sein Film fragt zumindest mal wieder, was eigentlich das Kino gerade so macht. Und versucht sich an der vorsichtigen Überlegung, dass nicht sterben kann, was erst noch geboren werden muss. Ein eher trotziger denn wuchtiger Schlag ins Gesicht des real existierenden Kinos, aber immerhin ein Schlag. Ob man diese Filmkunst, die Greenaway da vorschwebt, triumphieren sehen will oder lieber zurückschlägt, ist schließlich eine andere Frage.
Neue Kritiken

Primate

Send Help

Little Trouble Girls

White Snail
Trailer zu „Eisenstein in Guanajuato“




Trailer ansehen (4)
Bilder




zur Galerie (8 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.









