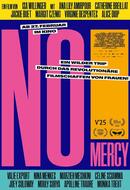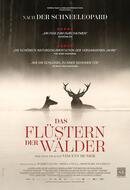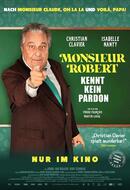Die Tage wie das Jahr – Kritik
DOK Leipzig 2018: Ein Ort, der die Sinne erst einmal abstößt. Othmar Schmiderer entdeckt in Die Tage wie das Jahr behutsam die Schauwerte eines österreichischen Bauernhofs und legt eine Welt frei, die auf wackligen Beinen steht.

Geburt eines Schafes: Langsam kündigt sich das Neugeborene an. Erst tropft die Flüssigkeit nur, dann fließt sie aus der Mutter heraus. Hinterher kommt ein großer Schwall Blut, dann ein kleines verschleimtes Etwas, wie in einer Blase gefangen, dann ein noch größerer Schwall Blut. Ein Ereignis, das in seiner Visualität im wahrsten Sinne des Wortes abstoßend ist. Zumindest wenden die meisten Zuschauer im Kinosaal ihren Blick voller Ekel weg von der Leinwand. Dieses Etwas, das da im gelblichen Schleim gehüllt liegt, scheint noch nicht wirklich ein Schaf. Erst muss die Mutter kommen, es beschnuppern und dann sanft am ganzen Körper mit der eigenen Zunge bearbeiten. So kommen langsam die Augen zum Vorschein, dann die Ohren, dann das Fell, und ist der Schleim dann ganz weg, hat dieses Etwas die wollige Materialität, die so wichtig für die menschliche Vorstellung von diesem Tier ist. Noch beeindruckender als die Freilegung des eigentlichen Wesens durch die mütterliche Zunge ist, wie schnell die Blicke der Zuschauer sich wieder zur Leinwand wenden. So abstoßend das Neugeborene gerade noch war, so anziehend ist es nun, wie es da auf seinen fragilen Beinen steht.
Anziehender Rhythmus

Mit einem Bauernhof geht es vielen Menschen wohl ähnlich. Der Geruch der Gülle und der Tiere in den Ställen, oder auch einfach nur der viele Dreck. Ein Ort, der die Sinne erstmal eher abstößt als anzieht. Othmar Schmiderer begleitet für seinen neuen Dokumentarfilm Die Tage wie das Jahr den Alltag auf dem österreichischen Bauernhof von Gottfried und Elfriede Neuwirth. Er sucht mit seinem Blick dabei ausschließlich die Arbeit, die die beiden Bauern selbst verrichten und findet darin einen ganz eigenwilligen, ja einen anziehenden Rhythmus. Gekonnte, gezielte, schnelle, aber auf keinen Fall mechanische Handgriffe: Vom Ziegenmelken über das Schleudern der Bienenwaben bis zum Hüten und Schären der Schafe. Vom Mähen des Ackers, über die Herstellung von Käse bis zum erfolgreichen Verkauf. Überall fließt es, raschelt es, summt es, läuft etwas, ist etwas in Bewegung, hat etwas Ertrag – überall entsteht Leben, wie in der Geburtsszene.
Zurückhaltende Form, fragiles Sujet

Dabei begegnet Schmiderer der mühevollen Arbeit der Neuwirths eigentlich mit einer distanzierten Form, mit einer angenehm zurückhaltenden Beobachtung des landwirtschaftlichen Alltags für den Zeitraum eines Jahres. Aber es ist ein liebevoller und ein neugieriger Blick, der hier am Werk ist. Kein bohrender, der nach etwas sucht, das sein Sujet gar nicht hergeben kann. Sondern einer, der behutsam die Schauwerte dieses Ortes entdeckt. Die Fülle an Tätigkeiten vom Bestellen der Felder über das Füttern der Tiere zum Verpacken der Produkte, und auch die Büroaufgaben, die noch in Arbeitskleidung am Schreibtisch verrichtet werden. Einfach die mühevolle Arbeit, die Agrarwirtschaft ist, und besonders die unaufgeregte Selbstverständlichkeit, mit der sie ihre Produkte in den Regalen eines Supermarkts präsentiert.

Aber auch manchmal die Zukunftsangst, die diese Tätigkeit mit sich bringt. Es sind überhaupt nur wenige Dialoge, die Schmiderers Kamera einfängt, und wenn sie dann vorkommen, sind sie so beiläufig wie der Rest des Films und stechen doch heraus. Von Trockenzeiten oder zu viel Regen ist dann mal die Rede. Sogar davon, dass man sich seit 30 Jahren schon immer irgendwie durchgeschlagen habe. Es hat einen Grund, dass Schmiderers Neugier keine bohrende ist: Nicht nur das neugeborene Lamm, auch der Bauernhof selbst steht auf ziemlich wackeligen Beinen.
Neue Kritiken

Marty Supreme

Father Mother Sister Brother

The Day She Returns

Prénoms
Bilder zu „Die Tage wie das Jahr“




zur Galerie (10 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.