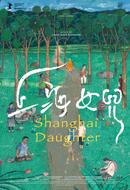Tagebuch einer Kammerzofe – Kritik
Eine Ära der Unterwerfung. Lea Seydoux versucht sich als trotzige Kammerzofe an einer alternativen Emanzipation.

Bewerbungsgespräch einer Kammerzofe. Die Hierarchien zwischen Céléstine (Lea Seydoux) und ihrer neuen Herrin (Clotilde Mollet) sind klar abgesteckt. Während die biestige Chefin sicher gehen möchte, dass sie sich eine saubere und fleißige Hilfskraft ins Haus holt, versucht das Mädchen, so gut es geht diesem Bild zu entsprechen. Aber etwas stimmt nicht bei diesem Vorstellungsgespräch –der Blick von Céléstine drückt keine Unterwürfigkeit aus, sondern Verachtung. Der Mund sagt „Ja, Madame“, aber die Augen sagen „Leck mich!“. Lea Seydoux, in deren sinnlichem Gesicht sich ohnehin immer eine gewisse Arroganz verbirgt, ist für so eine trotzige Rolle wie gemacht. In Tagebuch einer Kammerzofe (Journal d’une femme de chambre) spielt sie eine junge Frau, die sich mit ihrem sozialen Status nicht abfinden will. Wenn die Tyrannin mit dem Glöckchen schellt und der gellende Klang bis in den Garten dringt, dann reagiert Seydoux erstmal mit einem Augenrollen. Und je größer die Schikanen werden, je öfter die Herrin Céléstine mehrmals die Treppen rauf und dann wieder runter scheucht, bis diese kaum mehr atmen kann, desto stärker wird der Hass der jungen Frau.
Geilheit liegt in der Luft

In der mittlerweile dritten Leinwandadaption von Octave Mirbeaus Roman – die anderen beiden sind von Jean Renoir und Luis Buñuel – inszeniert Benoît Jacquot die Wut seiner Protagonistin als Resultat eines gesellschaftlichen Abstiegs. Dass Céléstine denkt, sie sei besser als ihre eher rustikalen und einfältigen Arbeitskollegen, liegt an ihrer Vergangenheit. Die beiden Rückblenden, die den Erzählfluss kurz unterbrechen, sind Erinnerungen an eine schönere Zeit. Damals, im schwer angesagten Paris, leuchtete nicht nur die Sonne heller als in der normannischen Provinz, auch das Lächeln der Heldin war noch nicht getrübt. Bedienstete sein, das hieß Teil einer Familie sein und am Luxus der Anderen teilzuhaben, zumindest fast Doch nachdem sich Céléstine in ihrem Freiheitsdrang nicht einschränken lassen will, den schwindsüchtigen Sohn der Familie besteigt und dieser daraufhin das Zeitliche segnet, bricht für sie eine neue Ära an.

Tagebuch einer Kammerzofe wirkt zunächst reichlich unauffällig, wie eine gediegene Literaturverfilmung ohne besondere Alleinstellungsmerkmale. Jacquot unterwirft den Stoff keiner radikalen Neudeutung, sondern entwickelt seinen Film sehr klassisch aus der Handlung des Romans. Ähnlich wie in Leb wohl, meine Königin! (Les adieux à la reine, 2011) zeigt er dabei jedoch, wie sich mit kleinen, aber prägnanten ästhetischen Entscheidungen die Last des verstaubten Historienkinos abwerfen lässt. Das geschieht etwa durch den Einsatz einer Handkamera, die dem Monumentalen etwas Unmittelbares entgegensetzt, durch nahe Einstellungen, die den Blick von altem Klimbim auf die Figuren lenken und vor allem durch die wiederkehrenden Zooms, die wie kurze emotionale Beschleuniger wirken. Oft geraten dabei die Augen der Schauspieler ins Visier. Die ohnehin schon schmierigen Blicke des abgestumpftem Kutschers Joseph (Vincent Lindon) wirken mit jedem Zoom noch durchdringender. Überhaupt macht es Jacquot sichtlichen Spaß, die sexuell aufgeladene Stimmung festzuhalten, die sich um die Wende zum 20. Jahrhundert hinter den guten Manieren des Großbürgertums versteckt. Während die Dreyfus-Affäre durch die Medien geistert, liegt in der Normandie vor allem Geilheit in der Luft. Sex ist für Jacquot dabei nicht nur ein menschliches Grundbedürfnis, sondern auch ein Mittel, um Macht auszuüben.
Grenzen der Selbstbestimmung

Die Bediensteten werden ganz offen wie Sklaven behandelt. Für die Frauen kommt dabei aber noch ein weiteres Schicksal hinzu. Dienen, das heißt für sie nicht nur die Betten machen oder den Nachttopf schrubben, sondern auch, dem Hausherrn jederzeit sexuell zur Verfügung zu stehen. Es ist ein mitleidsloser Kreislauf, der nur dem Begehren reicher Männer folgt. Wenn die Mägde schwanger werden, schickt man sie einfach weg und holt die nächste. Jacquot betont, dass Céléstine auch in sexueller Hinsicht eine selbstbestimmte Heldin ist. Den älteren Herren, die sie umschmeicheln, begegnet sie mit einem koketten Augenaufschlag, zeigt ihnen aber auch sehr schroff ihre Grenzen auf. Schlafen tut sie ohnehin nur mit wem sie will. Dass sie am Schluss ausgerechnet bei Joseph – einem Grobian, Antisemiten und vielleicht auch Kinderschänder – bleibt, wirkt zunächst wie ein radikaler Kurswechsel. So als würde sie sich nur in seine zerfurchten Arme begeben, um nach ihrem Angestelltenverhältnis noch einen weiteren Akt der Unterwerfung zu vollziehen.

Das Interessante an Tagebuch eine Kammerzofe ist jedoch, dass er das klassische Täter-Opfer-Schema hinter sich lässt. Céléstine verschreibt ihr Leben zwar letztlich Joseph, von ihrer Stärke büßt sie dadurch aber nichts ein. In dieser Hinsicht hat Jacquot einen sehr aktuellen Film gedreht. Wenn heutzutage nämlich von Emanzipation geredet wird, tauscht man häufig einfach einen Zwang (den patriarchalen) gegen einen anderen (den Zwang zur Unabhängigkeit) aus. Dabei definiert sich Selbstbestimmung, wie man an Céléstine sehen kann, gerade durch die Entscheidungsfreiheit, wem man sich wie hingeben möchte.
Neue Kritiken

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo

No Other Choice

Ungeduld des Herzens

Melania
Trailer zu „Tagebuch einer Kammerzofe“


Trailer ansehen (2)
Bilder




zur Galerie (6 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.