Der gute Hirte – Kritik
Robert De Niro bindet die Geschichte des amerikanischen Auslandsgeheimdienstes von den Anfängen während des Zweiten Weltkrieges bis zur Kubakrise an die fiktive Geschichte des Edward Wilson, verkörpert von Matt Damon.

„I live with a ghost“, konstatiert Margaret Ann, genannt Clover (Angelina Jolie), die Tochter eines Senators. Doch diesen Kosenamen hat sie jenem Geist, ihrem Mann Edward (Matt Damon), schon lange untersagt. Der ist eine Säule, ja sogar das Herz der CIA, wie es deren Chef, Richard Hayes, pathetisch formuliert. Die beiden kennen sich schon seit gemeinsamen Tagen in Yale, an deren Ende 1939 die Aufnahme in den Skull and Bones Club steht. Aus dieser freimaurerartigen Loge rekrutiert sich nicht nur die Elite des Landes, sondern bald auch die erste amerikanische Spionageabwehreinheit während des Zweiten Weltkriegs – und schließlich die CIA.
Es ist April 1961, die Schweinebucht-Invasion auf Kuba endete im Desaster, die Kennedy-Administration ist angeschlagen. Köpfe werden rollen und mehr noch – die gesamte Auslandsspionageeinheit steht vor der Auflösung. Es muss einen Verräter im innersten Zirkel geben. Edward Wilson werden Tonband- und abfotografierte Videoaufnahmen zugespielt, die zur Enttarnung des schwarzen Schafes führen sollen. Eine Frau flüstert der verdächtigen Person ins Ohr: „You are safe here with me.“ Es geht um Sicherheit und Vertrauen.

Autor Eric Roth ist Experte für die Fiktionalisierung historischer Stoffe. Dabei wählt er bei den häufig epischen Projekten zumeist die Zentralperspektive einer einzigen Figur, deren persönliches Schicksal mit dem einer bestimmten Epoche und im Grunde genommen einer ganzen Nation kurzgeschlossen wird. Am augenscheinlichsten und spielerisch am weitesten getrieben ist dies in Forrest Gump (1994). Bei The Insider (1999) gelang es Roth, genauso wie später in München (Munich, 2005), historische Fakten für ein persönliches Drama zu nutzen. Roth ist immer dann am stärksten, wenn der geschichtliche Hintergrund nicht die Oberhand gewinnt, sondern politische Brisanz und moralische Ambivalenzen die familiäre Ebene der Protagonisten in den Vordergrund rücken. Diese avancieren so zu archetypischen tragischen Helden in Filmen von zeitloser Ausdrucksstärke.

Auch Edward Wilson ist so ein tragischer Held, der sich zwar in Verstrickungen internationaler Dimension behaupten kann, dabei jedoch den Untergang der eigenen Familie heraufbeschwört. Das Verschwimmen privater und öffentlicher Dimension manifestiert sich bereits in den ersten Szenefolgen. Zunächst ist in grobkörnigem, die Kontraste verwischendem Schwarzweiß ein Paar beim Liebesspiel im Bett zu sehen. Die Kamera rückt ihnen hektisch nahe, zeigt Detailaufnahmen, der Raum ist topographisch nicht zu erschließen, nur sozial: es ist ein privater Raum. Der Raum der nächsten Szene ist ebenso ein privater: das heimische Büro Edwards, allerdings in dezent warme Farben getaucht. Der Bau eines Miniatursegelschiffs stellt die Verbindungslinie zwischen drei Generationen der männlichen Wilsons dar. Es ist Edwards einziges Hobby. Auf der folgenden Busfahrt erhält er Informationen für seinen Arbeitsplatz, den er gerade ansteuert. Die Handlung wird per Schriftzug chronologisch und örtlich bestimmt, quasi authentifiziert. Dieser Eindruck wird verstärkt bei der Einblendung von Archivmaterial. Die Schwarzweiß-Aufnahmen vom 18.04.1961 funktionieren als öffentliches Bildmaterial, sind durch die vorherige historische Einbettung der Handlung jedoch stark an die persönliche Geschichte Wilsons gekoppelt. De Niro betreibt hier eine Engführung historischer und privater Ebene. Zudem steht die Beschaffenheit der Bilder wie ein Mittler zwischen der schwarzweißen Eingangsszenerie und den Folgeszenen.

Fotografien und Mitschnitte der eingangs gesehenen Aufnahmen des Liebesspiels werden Wilson zugespielt und dienen ihm als Leitfaden zur Aufklärung des Schweinebuchtdesasters. Das Erforschen dieser audiovisuellen Beweisstücke erinnert zwangsläufig an Michelangelo Antonionis Blow Up (1966) und Francis Ford Coppolas Paranoia-Klassiker Der Dialog (The Conversation, 1974). Beide Filme operieren mit scheinbar eindeutigen Bildern: einem Schnappschuss und einer Überwachungsaufnahme. Bei Antonioni versucht der Fotograf über Vergrößerungen und Detailausschnitte zu einer Aussage mit Wahrheitsgehalt zu kommen. Auch bei Coppola geht es um detektivische Arbeit und die Frage nach dem Wahrheitsgehalt von Bildern. Wie in Der gute Hirte (The Good Shepherd) steht das eigentliche Ereignis am Anfang des Films. Der Zuschauer ist gleichzeitig Zeuge der sich vollziehenden Aktion und deren Überwachung. Von vornherein ist alles ausgebreitet, doch erst durch ständige Perspektivverschiebungen ergibt sich ein Panorama, das selbst als Gesamtbild brüchig bleibt.
De Niros Film hingegen spricht ständig von psychologischer Manipulation, die Manipulation von Bildern ist nie ein Thema. Auffällig hingegen ist der unreflektierte Materialeinsatz des Regisseurs selbst. Die stimmungsvolle Eingangssequenz entbehrt nämlich jeder Grundlage. Kein starres Überwachungsvideo, später abfotografiert und auf Tonband präsentiert, ist hier zu sehen, sondern ein Videoclip, der sich nicht in die Erzähllogik einfügen will. Überhaupt fällt es De Niro schwer, die vielen Erzählstränge und den sich über mehr als zwanzig Jahre erstreckenden Handlungszeitraum ökonomisch zu beherrschen. Dabei ist die Erzählstruktur so simpel wie uneffektiv: In den Apriltagen 1961 wartet Wilson auf Laborergebnisse der Experten, die das Bild- und Tonmaterial untersuchen. In Abständen weniger Tage erhält er einen Hinweis nach dem anderen. Diese Zeit- und Handlungsebene wird immer wieder unterbrochen von Rückblenden, die sich chronologisch dem Ausgangspunkt der Erzählung nähern. Als sich der Ort des Geschehens lokalisieren lässt, wird Wilson dort bereits von seinem Erzfeind erwartet. Der hätte ihn allerdings auch gleich und ohne Bilderrätsel einladen können.
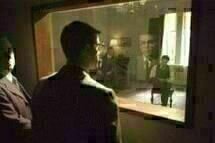
Matt Damons Wilson hat am Ende auf privater Ebene praktisch alles verloren – so wie auch Russel Crowes Insider Jeffrey Wigand, Eric Banas Avner in München und natürlich Gene Hackmans Harry Caul in Der Dialog. Und dennoch lässt einen das Schicksal dieses Mannes kalt. Matt Damon legt seine Figur als einen Stoiker zwischen Idealismus und Opportunismus an. Maske und Kostüm definieren die äußerliche Entwicklung des alternden Mannes fast ausschließlich über wechselnde Brillen, und die Inszenierung verdammt ihn über weite Teile des Geschehens zu Tatenlosigkeit. Da wiegt es schwer, dass der Schauspieler Nuancen seiner Figur, etwaige seelische Veränderungen, weder in Gesten, noch in Blicken oder Körperhaltung auszuformulieren weiß.
Seinen größten Fehler hat der große Schauspieler De Niro ausgerechnet bei der Besetzung begangen. Trotz eines namhaften Ensembles bleibt einzig das kurze Comeback Joe Pescis in Erinnerung. Wo es den Duos Coppola/Hackman, Mann/Crowe und Spielberg/Bana gelungen war, innerhalb eines spezifischen historischen Kontextes faszinierende Porträts zerrissener Protagonisten zu kreieren, da scheitern nun De Niro und Damon auf ganzer Linie.
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Neue Trailer
Kommentare
benno wagner
Heilige Einfalt! Die in Ihrer Kritik "Alterslosigkeit" des Protagonisten gehört doch zu den zentralen "Botschaften" der Story. Weder "Gott" (CIA) noch "ein Geist" (Wilson) altern ja. Soviel Verständnis möge man doch als professioneller Filmegucker noch aufbringen...
Rainer Henn
Ich glaube du interpretierst da zuviel in den Film Benno.
Zum Film selbst:
So kalt und ohne Spannung wurde dieses Thema wohl noch nie verfilmt.














2 Kommentare