Casa de los babys – Kritik
Ein Glücksfall: Nach sieben Jahren kommt der inzwischen auch nur noch drittneueste Film des großen amerikanischen Independent-Regisseurs John Sayles in die deutschen Kinos.

Mit Babyhänden beginnt der Film, dann folgt eine Szene, in der sich zwei mexikanische Kindermädchen über ihre Arbeit unterhalten und über ihre Schützlinge. Eine Gruppe Säuglinge, höchstens einige Monate alt, die in der „Casa de los babys“ auf weiße US-amerikanische Adoptivmütter warten. Bevor diese Adoptivmütter, die ebenfalls in der Casa, einer auf Adoptionen spezialisierten Herberge, untergebracht sind und bewirtet werden, im Film auftauchen, dauert es ein wenig. In den ersten gut zehn Minuten führt Sayles andere, mexikanische Akteure seines Films ein. Die Kindermädchen, dann die stolze Pensionsbesitzerin, die ihre Kundinnen verachtet und doch auf sie angewiesen ist, einen arbeitslosen ehemaligen Bauarbeiter, der im weiteren Verlauf des Films versuchen wird, einen amerikanischen Pass zu erstehen, schließlich einige Straßenkinder, also Waisen beziehungsweise von ihren Eltern verstoßene Kinder, die nicht in der Casa und anschließend im reichen Nachbarland gelandet sind.

Sayles lässt diese Figuren nicht fallen, wenn die sechs Amerikanerinnen auf den Plan treten, die nominell im Zentrum des Films stehen und die unter anderem von Maggie Gyllenhaal und Daryl Hannah, zwei feste Größen im US-Starsystem, verkörpert werden. Ganz im Gegenteil tauchen in dem Ensemblecast noch weitere Figuren auf, die alle mit der Casa auf die eine oder andere Art in Verbindung stehen: So etwa der Sohn der Besitzerin, der ebenfalls für die Amerikanerinnen arbeitet, sich aber während abendlicher Trinkgelage seine eigenen, sozialrevolutionären Gedanken macht. Ein Zimmermädchen hat einst ihre eigene Tochter weggeben müssen und blickt nun neidisch auf die Frauen, die in der Lage sind, sich die Mutterschaft zu erkaufen. Einer 15-jährigen Schwangeren blüht dasselbe Schicksal: Die Religion und vor allem die Mutter verbieten die Abtreibung, sie muss bei der Casa vorstellig werden, während der werdende Vater sich schon längst anderweitig umschaut.

Casa de los babys ist vor allem eines: ein weiterer Film von John Sayles. Ein weiterer Versuch, einen Schnitt durch die soziale Gegenwart zu legen, der gleichzeitig sanft, analytisch und empathisch ist. Ein Film, der weder auf einen dramaturgischen Effekt zielt, noch auf einen Stil, sondern der sich in den Dienst seines Materials stellt und sich diesem bis zu einem gewissen Grad anverwandelt. Mit eindringlichen spanischsprachigen Balladen auf der Tonspur, weichen Farben, einer zurückhaltenden Kameraarbeit. Nie aufdringlich ist dieser Film, schon gar nicht, wenn er den Waisenkindern, den Ausgestoßenen, dem Überschuss einer grausamen sozioökonomischen Zirkulation, folgt. Sayles, der zwecks Broterwerb als script doctor in Hollywood arbeitet, nimmt sich in seinen eigenen Regiearbeiten stets zurück, stellt sich in den Dienst des Materials, das er, in einer im besten Sinne journalistischen Manier, recherchiert, dramaturgisch aufarbeitet und Bewegungsbild werden lässt. Szene um Szene breitet Sayles ein soziales Panorama aus, langsam entsteht dabei zwar kein vollständiger Überblick, aber ein multiperspektivischer Eindruck der ökonomischen Totalität, in der sich die einzelnen Figuren wie Fische im Wasser bewegen, zu der sie aber nur in wenigen Momenten in der Lage sind, sich bewusst zu verhalten. Dazwischen immer wieder Bilder, die auf die dem Ökonomischen vorgängige sinnliche und emotionale Unmittelbarkeit menschlichen Lebens zielen: Tränen auf der Wange des Zimmermädchens, der Blick der Waisenkinder auf die Sternschnuppen im Himmel, die noch unkoordinierten Spiele der Säuglinge.

Casa de los babys gehört trotz vieler wunderschöner Momente nicht zu Sayles’ besten Filmen: Die Kleinkriege zwischen den werdenden Müttern, die in der Hitze Mexikos dank bürokratischer Hindernisse teilweise monatelang aus ihrem normalen Leben nehmen müssen und dabei eine Art Ersatz-Schwangerschaft durchleben, sind nicht immer wahnsinnig interessant; die Psychopathologien des weißen Amerikas, die dabei zutage treten, manchmal nahe an populären Klischees: die toughe New-Yorkerin, die sich selbst ihre eigene Verletzlichkeit nicht eingestehen will, die „born-again“ Christin, die gleichzeitig Alkoholikerin ist und ein Kind für Selbsttherapiezwecke sucht, schließlich eine völlig neurotische desperate housewife, die solange lügt, stielt, schimpft und besticht, bis sie eines der Kleinkinder in eine wahrscheinlich wenig erfreuliche Zukunft entführen darf. Dennoch kann man sich kaum zu sehr darüber freuen, dass dieser Film fast sieben Jahre nach seiner Weltpremiere einen kleinen Deutschlandstart erhält: Die Methode Sayles ist nach wie vor meilenweit entfernt von den zur Zeit vorherrschenden Strömungen im amerikanischen Indiekino – von der politischen wie ästhetischen Selbstbeschränkung der Mumblecore-Filme genauso wie vom durchkonventionalisiertem Wohlfühlkino der Sofia-Coppola-Tradition oder von aufdringlichen Formalismen à la Gus van Sant oder inzwischen leider auch Jim Jarmusch.

Casa de los babys zeigt, was Independent-Film auch sein kann: nämlich eine Form von Kino, die ihre relative Freiheit vom Diktat des Marktes nicht dazu nutzt, sich selbstdarstellerisch erst recht in eine Marke zu verwandeln („van Sant“, „Coppola“, „Mumblecore“), sondern die diese Freiheit als Möglichkeit begreift, das Kino wieder zu einem Ort des gesellschaftlichen Diskurses zu machen.
Neue Kritiken

Little Trouble Girls

White Snail

Winter in Sokcho

Die Spalte
Trailer zu „Casa de los babys“
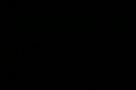
Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (8 Bilder)











1 Kommentar