Carré 35 – Kritik
Erst als Erwachsener erfährt Regisseur Éric Caravaca von seiner verstorbenen Schwester. Carré 35 nimmt ihr Grab in Casablanca zum Ausgangspunkt, um Familien- und Kolonialgeschichte zu verknüpfen.

Carré 35 ist ein Ort, den die Eltern des Regisseurs Éric Caravaca für immer hinter sich lassen wollten. Auf dem so betitelten Abschnitt eines Friedhofes in Casablanca liegt ihr erstes Kind begraben. Von dieser Schwester namens Christine erfahren Eric und sein Bruder erst im Erwachsenenalter. Die Eltern, besonders die Mutter, haben nach ihrem Tod einen Schlussstrich ziehen und ihr altes Leben hinter sich lassen wollen. So gibt es auch keine Aufnahmen des verstorbenen Kindes, sie wurden von ihnen selbst vernichtet. Das ist der Ausgangspunkt einer Dokumentation, die einen intimen Einblick in Caravacas Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit und Familiengeschichte gibt. Carré 35 ist eine Art psychoanalytische Suche nach dem Verdrängten, die dazu Fragen nach der Darstellbarkeit des Todes und dem Status von Erinnerung aufwirft.
Archivmaterialien von Spukhäusern
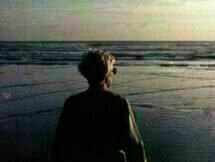
Die erste Sequenz zeigt das Haus der Familie, in dem die Schwester verstarb. Eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, die immer wieder durch den Film geistert: Die Kamera bewegt sich wackelnd auf ein vergittertes Fenster zu und taucht ein in die Schwärze des Inneren. In Verbindung mit der spannungserzeugenden Tonspur mutet das für sich wie ein Gruselfilm an, der alte Archivmaterialien von Spukhäusern voranstellt, um dann kriminologisch die Geschichte dahinter aufzudecken. Doch entwickelt sich Carre 35 zu einer sensiblen Auseinandersetzung mit familiären Beziehungen im Spannungsfeld gesellschaftlicher Verhältnisse.
Das Bild des Hauses wird zum Symbol für das Unbewusste erhoben, das der Film ergründen möchte. War die Vergangenheit etwas, worüber nie wirklich gesprochen wurde, so widersprechen sich nun auch die Interviewaufnahmen der einzelnen Familienmitglieder. Dass das verstorbene Kind an Trisomie litt, versucht die Mutter bis heute zu verdrängen. Das Grab war für sie nie ein Ort. Der Film setzt Super-8-Aufnahmen der elterlichen Hochzeit und eines unbeschwerten Alltags neben Aufnahmen der Unabhängigkeitskriege in Marokko und Algerien, wo die Eltern bis kurz vor dem Tod ihrer Tochter lebten, bevor sie nach Frankreich zogen. Bilder von Kriegsverbrechen werden mit französischen Nachrichten verschränkt, die das Gegenteil des Sichtbaren beschreiben und die Gräueltaten des Krieges zu vertuschen suchen.

Die Verbindung der Migrationsgeschichte der Eltern mit der Kolonialgeschichte Frankreichs sowie den Euthanasieverbrechen des NS-Regimes versucht essayistisch die Brücke zwischen individueller und gesellschaftlicher Verdrängung zu schlagen. Die Diskrepanz zwischen eigener Erinnerung und offizieller Geschichtsschreibung wird spürbar. Dabei bleibt alles Fragment. Die Lücken der Erzählung, die vor allem Lücken an Information und Dokumentation sind, werden durch die wiederholte Lektüre der Bilder immer wieder neu einzuordnen versucht. So funktioniert auch die Inkorporierung alter Archivmaterialien, weil Carré 35 nicht den Anspruch hegt, Kohärenz herzustellen, sondern sich als Gedanken- und Bilderstrom versteht.
Repräsentation des Nicht-Repräsentierbaren

Auch die letzte Sequenz ordnet sich darin ein: Aufnahmen aus einem Filmarchiv leiten über zu Bildern des Verfalls. Fotografie als Medium, das per se für Vergänglichkeit steht, verbindet sich mit dem Bewegtbild, das Lebendigkeit einzufangen scheint. Aufnahmen von Skeletten und mumifizierten Körpern schließen sich an. Den Tod zu zeigen und zu besprechen bringt uns an die Grenzen des medial Darstellbaren. Die Suche nach Bildern für Tod, Verlust, Trauma ist so nicht nur der Versuch, die eigene Familiengeschichte zu ergründen, sondern ebenso ein Versuch der Repräsentation des nicht Repräsentierbaren, des gesellschaftlich Tabuisierten. Die Montage einer Aufnahme des 2014 verstorbenen Vaters steht für Caravaca so vielleicht genau für das: Bilder zu enttabuisieren, nicht mehr zu schweigen, nicht mehr nicht zu zeigen. Die Produktion neuer Bilder ist der Versuch, die alten zu aktivieren, sie sprechen zu lassen.
Dass das Schweigen zu brechen ein schmerzhafter, aber notwendiger Akt ist, macht die stückweise Freilegung der Erinnerung deutlich, und sie zeugt davon, zu welchen Verdrängungsleistungen das Familiengedächtnis fähig ist. Die Mischung unterschiedlicher filmischer Aufnahmeweisen lässt die verschiedenen Zeitschichten einander überlagern. Der Besuch der gealterten Mutter am Grab ist das Ende einer traumartigen Reise durch die Zeit, die versucht, die Vergangenheit zu rekonstruieren.
Neue Kritiken

Hamnet

Die Stimme von Hind Rajab

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika
Trailer zu „Carré 35“


Trailer ansehen (2)
Bilder




zur Galerie (5 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.






