Can't Get You Out of My Head – Kritik
Opiatkrise, Klimawandel, COVID-19, Big Data: Der Dokumentarfilmer Adam Curtis gibt dem Publikum das Gefühl, im globalen Chaos das große Ganze zu erkennen. Mit dem siebenstündigen Wimmelbild Can’t Get You Out of My Head setzt er seine populäre Ideengeschichte fort.
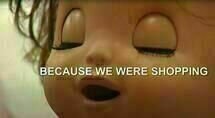
Adam Curtis ist als Filmemacher nicht leicht einzuordnen. Schon bei der Berufsbezeichnung wird es problematisch. Vom Selbstverständnis her eigentlich Journalist, ist Curtis seit den 1980er Jahren bei der BBC beschäftigt und besitzt dort das einzigartige Privileg, sich des gesamten, fast ein Jahrhundert umfassenden visuellen Archivs des Senders bedienen zu können. Das heißt nicht nur des Materials, das tatsächlich einmal ausgestrahlt wurde, sondern auch der Rohaufnahmen, aus denen spätere Fernsehbeiträge geschnitten wurden. Das führt zur dichten Textur seiner Filme, die zwischen Ausschnitten aus alten Fernsehreportagen, Werbung, Interviews mit vergessenen Figuren der Zeitgeschichte und alltäglichen Impressionen aus aller Welt hin und her springen, ganz so, als sei kein Gegenstand in Raum und Zeit Curtis’ Blick unzugänglich.

Gleichzeitig besitzt dieses eigentlich sehr zerstückelte Material eine gewisse ästhetische Kohärenz, da es nun mal durch den Filter einer einzigen Institution, eben des BBC, gegangen ist. Diesen ausgesprochen „britischen“ Charakter seiner Filme weiß Curtis gekonnt als Markenzeichen einzusetzen, und er verstärkt das noch durch seine professoral-erhabene Erzählerstimme, die die Montagen aus Archivmaterial stets begleitet, sowie durch die Musikauswahl, die meist aus den Beständen der alternativen britischen Elektronik der 1990er Jahre schöpft und von Massive Attack über Aphex Twin bis zu Burial reicht. Bereits avant la lettre waren Curtis’ Filme auf diese Weise Teil der Ästhetik der Hauntology, wie sie Kulturkritiker Mark Fisher in den frühen 2010er Jahren auf seinem Blog k-punk beschrieben hat. Hauntology ist, kurz gefasst, Fishers Begriff für eine künstlerische Tendenz, die durch einen Filter der Nostalgie auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts zurückblickt, als utopische Zukunftsvisionen in Politik und Kunst noch ein Versprechen auf baldige Erfüllung enthalten haben. Im 21. Jahrhundert leben wir ihm zufolge in der Gegenwart „geisterhafter“, unerfüllter Zukunftshoffnungen.
Viel Gespür für populäre Verknappung

In Curtis’ neustem Film Can’t Get You Out of My Head wird diese ästhetische Verwandtschaft auch inhaltlich greifbar. Der Regisseur setzt in diesem Film sein Projekt einer populären Ideengeschichte fort, an dem er seit über zwei Jahrzehnten arbeitet. In Filmen wie The Century of the Self (2002) spürte er der fortschreitenden Psychologisierung des amerikanischen Kapitalismus infolge einer verflachten Auslegung der Psychoanalyse nach. In All Watched Over by Mashines of Loving Grace (2011) widmete er sich dem Zusammenspiel szientistischer Erklärungsmodelle menschlichen Handelns mit kybernetischen Steuerungsinstrumenten in der Politik. All diese Aspekte finden sich auch in Curtis’ neuster Arbeit wieder, dieses Mal aber ergänzt um einen neuen Schwerpunkt, der über sieben Stunden hinweg in geradezu epischer Breite entfaltet wird: das Aufkommen der Ideologie des Individualismus als des einzigen politischen Bezugsrahmens und das gleichzeitige Versiegen revolutionärer politischer Entwürfe auf globaler Skala.

Bei der Illustration dieser abstrakten Diagnosen beweist Curtis wieder einmal viel Gespür für populäre Verknappung, indem er den Film um parallel erzählte Einzelschicksale konstruiert, in denen sich seine Befunde spiegeln. Großen Raum nimmt etwa Michael de Freitas ein, ein Black-Power-Aktivist, der Mitte der 1970er Jahre wegen Mordes zum Tode verurteilt wurde, oder Jiang Qing, die chinesische Politikerin, vierte Ehefrau Maos und maßgebliche Architektin der Kulturrevolution, die sich 1991 hochbetagt das Leben nahm.
Platz für jede zirkulierende Schreckensnachricht

Die übergeordnete Tendenz von Curtis’ Großnarrativ ist somit leicht nachzuvollziehen. Erst in der letzten Folge wird aber klar, wie die zahlreichen Geschichten von scheiternden Revolutionären mit diversen anderen Entwicklungen zusammenhängen, die in die Erzählung aufgenommen werden: Da wird etwa kurz von der Verbreitung des Beruhigungsmittels Valium in den USA der 1960er berichtet, zu dessen zahlreichen Suchtopfern First Lady Pat Nixon gehörte, oder ein kurzer Abriss des Aufkommens moderner Verschwörungstheorien im Umfeld des Kennedy-Attentates gegeben.

Im Gegensatz zu Curtis’ früheren Filmen, die ihre Erzählstränge meist zu einer übergeordneten These integrierten, werden nicht alle diese Anekdoten einer gemeinsamen Pointe zugeführt. Stattdessen wird deutlich, was Curtis gemeint haben kann, wenn er seinem Film den Untertitel An Emotional History of the Modern World hinzufügte: Wie in einem großen Wimmelbild findet sich in den sieben Stunden von Can’t Get You Out of My Head fast jeder Topos wieder, der zur Zeit durch den zeitdiagnostischen Diskurs geistert und die Gemüter der Öffentlichkeit bewegt. Von der Opiatkrise über die sich zuspitzende Klimakatastrophe und COVID-19 bis hin zum Aufstieg von Big Data und dem damit verbundenen Überwachungsapparat widmet Curtis jeder heute zirkulierenden Schreckensnachricht vom traurigen Zustand der modernen Welt wenigstens eine kurze historische Herleitung. Die „emotionale Geschichte“, die sich daraus ergibt, ist weniger die der Jahrzehnte, von denen der Film handelt, als die des gegenwärtigen Medienkonsumenten, der kaum noch fähig ist, sich in der raschen Abfolge der auf ihn einprasselnden Hiobsbotschaften zurechtzufinden.
Vom BBC-Eigenbrötler zum Influencer wider Willen
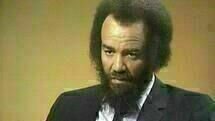
Curtis’ Fangemeinde im Internet wächst stetig, obwohl ihm seit Jahren mangelnde Seriosität und theoretische Nonchalance vorgeworfen werden und zahlreiche Parodien seines höchst wiedererkennbaren Stils im Netz kursieren (besonders schön hier). Mit der Verbreitung seiner Filme auf YouTube kam gewissermaßen zusammen, was zusammengehörte, und Curtis wurde von einem wenig bekannten Eigenbrötler im BBC-Spätprogramm zu einer Art Influencer wider Willen. So steht er nun in einer Reihe mit Leuten wie Slavoj Žižek oder Jordan Peterson und teilt mit diesen auch das Talent, sein Publikum durch das Nebeneinander von konkretem Beispiel und theoretischer Verallgemeinerung das stetige Gefühl zu vermitteln, im Chaos des globalen politischen Geschehens das „große Ganze“ zu erkennen. Im Gegensatz zu Žižek und Peterson, die sich jeweils klar auf der links-marxistischen bzw. konservativen Seite des politischen Spektrums verorten, verweigert Curtis aber eine klare politischen Stellungnahme.

Möglicherweise aus dem Wunsch heraus, sich von keiner der ihm verhassten politischen Ideologien vereinnahmen zu lassen, macht dies seine Filme allerdings gleichermaßen anschlussfähig an linke wie rechte Vorstellungen über die Missstände der Gegenwart. Sind die zahlreichen verpatzten revolutionären Umwälzungsversuche in einen Lernprozess integrierbar, oder machen sie nur deutlich, dass jedes Aufbegehren von vornherein zum Scheitern verurteilt ist? Die schiere Häufung der Katastrophen und Curtis’ Weigerung, den von ihm porträtierten sozialen Bewegungen so etwas wie sekundäre positive Effekte zuzuerkennen, die auch im Angesicht eines vordergründigen Scheiterns Bestand haben könnten, legen implizit die zweite Option nahe. Der Horizont der Hoffnung, den die letzten zehn Minuten des Films entfalten, erscheint in diesem Kontext wenig überzeugend. Wenn man am Ende trotzdem nicht in Depression versinkt, dann weil die pure Vielfalt von Einzelanekdoten den Determinismus von Curtis’ Gesichtsversion am Ende untergräbt. Eine Welt, in der ein verschrobener Acid-Head wie Kerry Thornley mit einer ausgedachten Geschichte über Illuminaten die CIA an der Nase herumführen kann oder eine bedeutungslose chinesische Filmschauspielerin zur mächtigsten Frau des Landes aufsteigt, scheint eine Welt zu sein, in der im Prinzip alles möglich ist.
Neue Kritiken

Send Help

Little Trouble Girls

White Snail

Winter in Sokcho
Trailer zu „Can't Get You Out of My Head“

Trailer ansehen (1)
Bilder
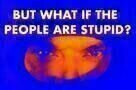

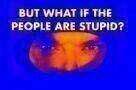

zur Galerie (15 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.







