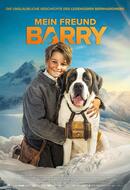Ayka – Kritik
Muttermilch, die ins Leere läuft: Sergei Dvortsevoy hetzt eine illegalisierte, verschuldete Kirgisin durch ein raues Moskau, während irgendwo ein Baby nach einer Brust schreit. Ayka fährt die härtesten Geschütze auf: Handkamera und Hundewelpen.

Im Bildkader machen sich in der ersten Einstellung von Ayka vier Babys breit, sie liegen eng aneinander und in unterschiedlichen Gemütslagen auf einem Tisch, haben wohl gerade mal die erste Grundsäuberung nach Ankunft auf der Welt hinter sich. Der Film wird diese Babys direkt wieder verlassen und erst ganz am Ende wieder explizit auf sie Bezug nehmen. Da sind wir dann nicht mehr im Kreißsaal, sondern auf der Veterinärstation: Eine verletzte Hündin, die von einer schick gekleideten Dame gebracht wird, soll vor der Behandlung noch schnell ihre Welpen mit Milch versorgen, um den Eingriff zu erleichtern. Schon wieder also vier Babys im Bild, die selig an ihrer Mama nuckeln. Im Tierreich gelingt, was dem Menschen verwehrt wird, zumindest jemandem wie Ayka (Samal Yeslyamova), der Mutter eines der Neugeborenen vom Anfangsbild, die jetzt als Assistentin neben der Hundefamilie steht, während unter ihrem T-Shirt die eigene Milch ins Leere läuft.
Flucht nach vorn
Zwischen den Babybildern liegt eine Handkamera-Hetzjagd. Es ist nämlich Ayka selbst, die ihr Kind direkt nach der Geburt verlässt. Verschuldet, nach abgelaufener Arbeitserlaubnis illegal in Moskau, ist eine Mutterschaft für die Kirgisin nun mal gar keine Option, die nötigen Geldbeschaffungsmaßnahmen nehmen ihren Körper völlig ein, lassen sie jeden psychologischen oder hormonellen Mutterimpuls unterdrücken. Also drückt sie in der ersten Sequenz lieber mit aller Macht das Fenster der Krankenhaustoilette auf und klettert nach draußen, flieht vor der Verantwortung, könnte man sagen, aber eigentlich rennt Ayka vor allem durch die Stadt, um pünktlich zu ihrem neuen Job in einer Hühnerschlachtanlage zu gelangen. Regisseur Sergei Dvortsevoy bleibt seiner Protagonistin den ganzen Film dicht auf den Fersen, wir sollen die Hektik, die Verzweiflung, das Leben am Rande der Gesellschaft hautnah miterleben.
Die vom bloßen Überlebenswillen angetriebene Vorwärtsbewegung durch diesen Film wird nur von Biologie ausgebremst: Ayka blutet nach und produziert Milch ohne Abnehmer, eine Frauenärztin, die natürlich weiß, dass das Gerede von einer Fehlgeburt eine schamlose Lüge ist, warnt sie vor einer drohenden Brustdrüsenentzündung, und immer wieder muss die junge Frau ihren Schmerz erleichtern und ins Leere stillen. In diesem Zustand ohne gültige Arbeitserlaubnis Arbeit finden, die bedrohlich mafiösen Gläubiger befriedigen, die ihr auf den Fersen sind – der Film schickt sich an uns zu zeigen, wie sich das vielleicht anfühlt. Er bereitet all diese Dinge nicht im Schnitt auf, er schickt uns in langen Einstellungen durch sie hindurch.
Keine Zeit für Close-ups

Ayka ist also ein Film, der Leid anhäuft, der Schlimmes an Schlimmes reiht, seinen Schematismus aber hinter einer formalen Stilübung verschleiert. Was an dieser Stilübung funktioniert: Tatsächlich ist nicht nur ihr Kind Ayka egal, wir sind es auch. Ayka rennt um ihr Leben und hat gar keine Zeit, sich ins Close-up zu drehen oder etwa Nebenfiguren mit Plädoyers zu belästigen, die eigentlich an uns gerichtet sind – zu keiner Zeit also versucht Dvortsevoy, uns diese Frau als Figur, als Mensch, der unseres Mitleidens würdig ist, näherzubringen. Und eine Mutter, die vorm Kind wegrennt, die das eigene Leben ungerührt dem von ihr geborenen vorzieht und dann weniger mit Gewissensbissen als mit den ganz körperlichen Folgen einer Geburt zu kämpfen hat, das ist eigentlich eine spannende Figur für eine solche kompromisslose Jagd.
Schließlich aber sind das ständig Aykas Beine herunterlaufende Blut, die ins Leere fließende Muttermilch keine Leitmotive, mit denen Dvortsevoy mehr anstellt, als sie zur Elendsmarkierung zu benutzen. Die Trennung von Mutter und Kind, sie ist schließlich nur ultimativer Beweis für eine unmenschliche Gesellschaft; spätestens wenn Ayka bei den Hundewelpen angekommen ist, ist das glasklar. Und schließlich legt er der kirgischen Mutter doch noch ihr Kind in den Arm und schickt sie damit endgültig in ein Bild vollständiger Ausweglosigkeit, aus der sie nur noch der Abspann befreien kann.
Neue Kritiken

No Bears

Scarlet

Marty Supreme

Father Mother Sister Brother
Trailer zu „Ayka“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (4 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.