Auslöschung – Kritik
Wenn alles einfach wild mutierte: Alex Garland schickt eine Gruppe von fünf Frauen in höchstes Gefahrengebiet, um statt dem Weltschmerz einen Weltkrebs zu bekämpfen oder wenigstens eins mit ihm zu werden. Auslöschung ist ein utopischer Albtraum auf Zellebene.
Wir sprechen hier nicht von der Einheit der Substanz, sondern von der Unendlichkeit von Modifikationen, die auf ein und derselben Ebene des Lebens Teile voneinander sind. (Gilles Deleuze und Félix Guattari, Tausend Plateaus)

Eine Sache, für die sich dieser Film mal so gar nicht interessiert, und das macht ihn mal so richtig sympathisch, ist der Tod. Da wird zwar gleich in der ersten Sequenz ein tröstender Kollegenarm auf Lenas Schulter gelegt, die Geste mit den deutungsvollen Worten „Es ist jetzt schon ein Jahr her“ und einer Party-Einladung garniert, und schon sehen wir einen Schnitt später die so angesprochene Biologin (Natalie Portman), wie sie lieber andächtig das Schlafzimmer mit dem Ehebett umdekoriert, als auf Partys zu gehen, lieber ganz allein in einer gemeinsamen Vergangenheit lebt, von schmerzhaften Erinnerungen heimgesucht. Doch dann stolpert noch in derselben Szene der vermeintlich Verstorbene in eben dieses Schlafzimmer, und das ist nicht einmal halluziniert. Und so setzt der Plot von Alex Garlands Auslöschung ein.
Das Tier-Werden des Menschen ist real, ohne dass das Tier, zu dem er wird, real ist.

Später, wenn dieser Plot längst seinen selbstzerstörerischen Gang geht, wenn fünf Frauen bei ihrer Expedition ins Krisengebiet das Hauptquartier der militärischen Vorgänger-Expedition finden, dann stellt sich die unheilvolle Frage, warum einige der an die Wand gekritzelten Männernamen durchgestrichen sind. Aber auch hier übernimmt das Desinteresse des Films gegenüber dem Tod: „Let’s not jump to conclusions!“, mahnt die eine die anderen. Und als bei dieser Mission dann wirklich mal eine draufgeht, bleibt sie dem Film zumindest als Stimme noch erhalten, die aus dem Inneren irgendeines riesigen Bärenviechs, das den Rest der Truppe gerade attackiert, markerschütternd um Hilfe ruft. Vielleicht ist es nicht mehr ihr Leben, das da insistiert, aber es ist ein Leben. Nein, mit dem Tod hat es dieser Film glücklicherweise nicht so. Die Auslöschung, von der im Titel die Rede ist, sie ist als eine lebensbejahende Sache zu begreifen.
Alles, was abweicht, lässt sich als Sein bezeichnen.

Auslöschung lässt sich mit dieser Formel der Destruktion als Produktion auf keinen Punkt, aber auf seine zentrale Bewegung bringen. Noch bevor Kollegenarme sie trösten wollen, hören wir Lena anfangs zu, wie sie ihren Studenten etwas über Zellteilung erklärt, „the origins of life itself“, aber die Zellen, die wir sehen, anhand derer sie das alles erzählt, sind Krebszellen, „female patient, early 30s“, also auch nur solche, für die Leben und Zerstören dasselbe sind, auch wenn wir Menschen das anders sehen mögen.
Die Perspektive des Menschlichen ist das, was in Auslöschung zur Disposition steht, vielleicht sogar das, was ausgelöscht wird. Was da als Herausforderung auf Lena und ihre Expedition zukommt, ist nicht nur nicht menschlich, es sinnentleert die Vorstellung des Menschlichen. Da ist etwas eingeschlagen in einem Leuchtturm, eine Zone ist erschienen, irgendwo in der US-amerikanischen Pampa, eine Zone, die nur „the shimmer“ genannt wird, die sich langsam ausdehnt wie ein Krebs, eine Zone, in die die Regierung fortwährend militärische Expeditionen schickt, von denen nie jemand zurückkehrt – bis auf Kane (Oscar Isaac), Lenas nun doch nicht Verflossenen, dem’s nach seiner Rückkehr aber gar nicht gut geht.
Jede Mannigfaltigkeit vereinigt in ihrem Werden Tiere, Pflanzen, Mikro-Organismen und verrückte Teilchen, eine ganze Galaxie.

Das Militär versagt, die Wissenschaft muss es richten, und das sind für diesen Film ausnahmslos Frauen: Psychologin Dr. Ventress (Jennifer Jason Leigh), Sanitäterin Josie (Gina Rodriguez), Physikerin Anya (Tessa Thompson) und Geomorphologin Cass (Tuva Novotny). Allesamt sind sie Selbstzerstörerinnen: Die Anführerin ist unheilbar krank, die anderen sind trockene Alkoholikerinnen, haben Ritznarben am Arm oder eben geliebte Menschen verloren. Psychische Schmerzen, aber Garland will die nicht psychologisch verstanden wissen. Selbst die Psychologin versteht unsere selbstzerstörerischen Praktiken, das Rauchen, das Trinken, das Lieben und Sich-Trennen als in uns eingebaute Impulse. „You’re probably better equipped to explain this than I am“, sagt sie zu Lena, das Psychologische dem Biologischen anvertrauend.
Und genau das ist es, was die Frauen in der Zone finden: biologische Impulse. Es fängt an mit paradoxen Pflanzen, Blüten, die nicht einmal der gleichen Spezies angehören und doch am selben Zweig erwachsen, es gesellen sich bald Krokodile mit Haifischzähnen dazu, irgendwann tauchen Bäume in Menschenform auf, ein einziges molekulares Wuchern in schillernden Farben, und dann noch dieses Bärenviech. Eine Zone der Deterritorialisierung, ein Reich des Werdens, der Ununterscheidbarkeit, und wie schon Deleuze und Guattari wussten, als sie diese Begriffe erschufen, vereint eine solche Zone immer das Schaffen und das Zerstören, besteht ein solches Reich immer aus kreativen Flucht- und gefährlichen Vernichtungslinien, ist eine solche Vorstellung immer zugleich Utopie und Albtraum.
Jede Faser ist eine Faser des Universums.

Der Film selbst beschreibt die Sache ungleich poetischer: „The shimmer is a prism that refracts DNA.“ Wie ein Prisma also bricht diese Zone nicht nur Lichtstrahlen, sondern Moleküle, lenkt Zellen um, setzt die Dinge neu zusammen, und zwar alle Dinge, die sich in ihr bewegen, das heißt auch die sogenannten Filmfiguren, an deren Menschlichkeit wir uns festhalten, derer wir uns aber bald nicht mehr sicher sein können. Und schließlich wird über die extraterrestrische Kraft, die irgendwie dann doch hinter dem ganzen Schimmer steckt, endlich mal die entscheidende Frage gestellt: nicht, was sie will, sondern, ob sie will. Mögen Androiden von elektrischen Schafen träumen, so viel sie wollen, was lebt da eigentlich in uns und im Anderen?
Affekte sind Arten des Werdens

Ein Wort ließe sich noch verlieren über die hierzulande völlig verkorkste Karriere dieses Films, der für Paramount „zu intellektuell“ für einen Kinostart war und den deshalb Netflix irgendwo in seinem Programm versteckt. Absurd ist es schon, dass er da in personalisierte Algorithmen sich einfügt, obwohl er die Vorstellung der Person problematisiert, und schrecklich traurig ist es natürlich auch, diesen Film mit seinem auch visuellen Wagemut nicht auf der ganz großen Leinwand sehen zu können.
Andererseits: Wenn es einen Film gibt, der einen Trauermarsch nicht verdient hat, dann dieser. Ein Film, der jeden Tod, auch den des Kinos, links liegen lässt. Und in gewisser Weise ist Auslöschung auch ein Film, der wenigstens in seinem Denken wenig interessiert ist am Kinofetisch der Überwältigung, der weniger einen Begriff vom kinematografischen Affekt im engen Sinne hat als eine Vorstellung vom Affekt als genuinem und vielleicht “einzig wahrem” Lebenselixier – eine Vorstellung, die auch das Kino eher als affektive Einstellung zur Welt denn als affektives Medium denkt.

Da sitzen also kurz nach seiner Rückkehr Kane und Lena einander gegenüber an einem Tisch, das wiedervereinte Paar, und halten sich die Hände, nur dass direkt vor dieser zärtlichen Berührung ein Wasserglas ein bisschen weird im Weg steht, uns den direkten Blick auf diese Berührung verwehrt, zugleich unsere Perspektive auf diese Berührung verzerrt. Nicht um die Liebe geht es, nicht um das, was diese Berührung bedeutet, sondern um die Berührung an sich und den Affekt, der sie hervorbringt, und auch um den Affekt, den sie hervorbringt; nicht um die Innerlichkeit zweier Figuren, sondern um die Zone der Ununterscheidbarkeit, die sich im Außen zwischen ihnen auftut. Immer dort, wo wir Festes vermuten, wird verflüssigt. Ein Wasserglas ins Bild zu rücken ist der tolle Move dieses Films, ein Move, der aus dem Sein ein Werden macht, und ein Move, den er nicht strebermäßig in die Welt philosophiert, sondern letztlich dann doch nur auf bekannte Sci-Fi-Motive variiert, oder man müsste natürlich sagen: mutiert.
Den Film kann man bei Netflix, Amazon und weiteren Anbietern streamen.
Neue Kritiken

Primate

Send Help

Little Trouble Girls

White Snail
Trailer zu „Auslöschung“

Trailer ansehen (1)
Bilder

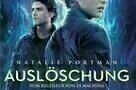


zur Galerie (13 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
dimas
vielen dank für diesen text – es ist sehr schön über dinge zu lesen und ihnen klar zu werden, mit denen man un(ter)bewusst während des films sympathisierte
Tobias
Alles nachvollziehbare Gedanken des Autors, auf die man durchaus so beim Schauen des Films kommen kann - die nötige Phantasie und eine ordentliche Portion Wohlwollen vorausgesetzt. Denn leider werden die den Gedanken zu Grunde liegenden philosophischen Themen im Film lediglich angedeutet und zu keinem Zeitpunkt fokussiert und mit der nötigen Tiefe unterfüttert. Es bleibt bei einem Sammelsurium an Schlagworten, vagen Anspielungen und oberflächlichen Ideen die Science-Fiction-Neulinge durchaus zum Nachdenken und recherchieren animieren können. Natürlich nur, so fern das furchtbare Pacing, die blassen Charaktere, die schlechten Effekte und die vorhersehbare, unlogische Handlung um mutierte Tiere noch Kraft dafür gelassen hat. So kann die Aussage des Produktionsstudios, der Film sei zu intellektuell für das gemeine Publikum, nur als zynische Marketing-Phrase verstanden werden, die man als anspruchsvoller Kritiker keinesfalls unterstützen sollte.
Till
Naja, philosophische Themen zu "fokussieren" sollte vielleicht nicht Aufgabe des Kinos sein, und mit einem Sammelsurium ist der Film ja eigentlich auch ziemlich perfekt geschrieben. Das mit den Pacing, den Figuren und den Effekten seh ich einfach nur komplett anders, aber dass die Handlung "unlogisch" ist, ist ja irgendwie der Punkt bzw. probiert der Film sich eben an anderen Logiken.
fifty
Wer etwas bessere Filme sehen will, sollte „Arrival“, „Monsters“ oder „Interstellar“ sehen. Wer einen großartigen Film will, sollte „Life“ von Daniél Espinosa sehen. Ich habe neulich von Alex Garland „ex machina“ gesehen und war begeistert und nun dieser Film. Wieder zeigen Sie, Herr Kadritzke, eine wundervolle Beobachtungsgabe, doch schöne Einstellungen und gedankliche Perspektiven hin oder her: Ich finde Tobias trifft es ziemlich gut, auch ich fand den Film blass und wenig originell. Wie die Figuren auf Traumata, Lebensbedrohung oder Außergewöhnliches reagieren, löste bei mir keine Sympathie aus, sondern Gähnen. Eine Lässigkeit im Umgang mit der Psychologie von Figuren kann ja wohltuend sein (mir fiele da Quentin Tarrantino ein, der das konsequent durchzieht), aber was wenn ein Film den eigenen Unglauben kein einziges Mal erfolgreich suspendiert? Das Finale langweilte mich dann derart, dass mir das Rezept klar wurde, mit dem immer gekocht wird, wenn eine gewisse Einfallslosigkeit herrscht: es werden ein paar Verstiegenheiten mit Musik und Effekten vermischt (Hauptsache Rätsel, Hauptsache Optik) um das Ding irgendwie zum Abschluss zu bringen. Insofern scheint mir dieses „willenlose“ Werk bei Netflix ganz gut aufgehoben.
Leander
Ich sehe hier ja eine Menge teutonischen Un-Willen auf den Film abregnen. Ich möchte mal eine Lanze für den brechen. Ist so eine Art "Unheimliche Begegnung der dritten Art" für Erwachsene. Für mich die interessanteste erster-Kontakt-Szene, die ich jemals im Kino, eh, auf dem Computerbildschirm gesehen hab. Sehr darwinistisch und audiovisuell beeindruckend. Und trotzdem in all seiner Unwahrscheinlichkeit doch realistisch. Und ja, Graus, das Bärenvieh! So hab ich mich schon lange nicht mehr in den Sessel gepresst.

















5 Kommentare