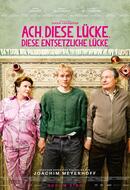Aus dem Leben eines Schrottsammlers – Kritik
Aus dem Leben des Sisyphos.

Die ersten Blicke in Danis Tanovics Aus dem Leben eines Schrottsammlers (Epizoda u zivotu beraca zeljeza) gehen direkt in die Kamera. Zwei junge Mädchen (Semsa und Sandra Mujic) in zartrosanen Joggingoutfits fläzen auf einer vernutzten Couch und starren geradeaus von der Leinwand. Das Bild wackelt, die Schärfe liegt leicht neben den relevanten Details, das natürliche Licht fällt durch speckig-weiße Gardinen. Eine Eröffnungseinstellung, die Manifest und Versprechen zugleich ist: Hier hat die reale Welt Gestaltungsmacht, Indizien eines dokumentarisch rückversicherten Naturalismus finden sich allerorten. Die beiden Mädchen, die im Film wie im wirklichen Leben Semsa und Sandra heißen, fügen sich in keine fiktiven Welten, die nicht ihre sind. Wenn real das ist, was widerständig bleibt, dann sind die beiden Garanten des Realen.
Für Aus dem Leben eines Schrottsammlers hat Tanovic eine filmische Form gewählt, die dem Reality-TV nicht ganz unähnlich ist: Er formt mit Laiendarstellern Geschehnisse nach, die jene wirklich durchlitten haben. Das heißt für das Spiel der Schauspieler, dass sie per „Reenactement“ in sich selbst die Differenz erzeugen, die der Film formal beansprucht: Spielen und Erleben, Fiktion und Dokumentation, so heißen ihre Pole. Die Kamera verfolgt konsequent und ausschließlich die Handlungen aller Protagonisten, der Schnitt etabliert so gut wie nie Atmosphären oder Situationen, die selbstgenügsam oder vom Welterleben der Figuren unabhängig wären. Jeder Raum öffnet sich im Durchgang, jeder Schauplatz erscheint erst in dem Moment, in dem man ihn betritt.

Dass all diese Regieentscheidungen, wie außerdem der Verzicht auf musikalische Untermalung und die Verwendung von Direktsound, sehr strenge Einengungen der Ausdrucksmöglichkeiten von Filmsprache und Weltdarstellung mit sich führen, liegt auf der Hand. Aber es ist fraglich, ob Tanovic in der Wahl seiner filmischen Mittel diese Einschränkungen mit den daraus resultierenden Konsequenzen für Zuschauerschaft (die außerhalb des Festivalbetriebs minimal sein wird) und Sujetvermittlung (die ein sehr starres Wirklichkeitsverständnis festschreibt) gut durchdacht hat. Denn rein thematisch begibt sich Aus dem Leben eines Schrottsammlers auf ein Feld, das nach Öffnung und Aufmerksamkeit in alle Richtungen verlangt.

Die Familie Mujic sind Roma, die vier leben in einem abgelegenen Dorf irgendwo in Bosnien. Die Armut der Roma und Sinti, dieser ewig marginalisierten, kulturell wie ökonomisch nirgendwo wirklich mit einberechneten Volksgruppen treibt sie seit Menschengedenken durch Europa. Im vergleichsweise gut aufgestellten Zentrum vergisst man das immer so lange, bis französische Präsidenten nach Grenzkontrollen und Zwangsausweisungen rufen oder die BILD von den Zigeunerdieben am Alexanderplatz berichtet. Es hat also auch nicht wenig mit unserem Wohlstand und seinen Gespenstern zu tun, dass bisher so wenige Filme zu den Wurzeln dieser bis heute schlecht verstandenen Migration zurückgehen.
Das Leben von Nazif (Nazif Mujic) erinnert stark an den allbekannten Mythos des Sisyphos: Die Armut muss immer bekämpft werden, aber sie lässt sich nie besiegen. Als Altmetallsammler lebt er von Tag zu Tag, und jeder hart errungenen Bezahlung stehen allseitige Bedürfnisse entgegen. Die Stromrechnung, das Essen, Benzin, Feuerholz. Doch als seine Frau Senada (Senada Alimanovic) nach einer Fehlgeburt unbedingt und schnellstmöglich operiert werden muss, da geht die tageweise ausgehandelte Balance von Arbeit und Überleben verloren. Ohne Versicherung weigern sich die Krankenhäuser zu operieren.

Tanovic geht es vor allem um die alltäglichen Handlungen und ihre ökonomische Bedeutung. Eingangs sehen wir, wie lange Nazif und ein Kumpel arbeiten müssen, um knappe 70 Marka pro Kopf zu bekommen: einen Tag. Wenn die Ärzte also 980 Marka für die Operation verlangen und die Zeit knapp ist, dann verstehen wir die Dimensionen des Problems auf ganz lebenspraktische Weise. Diese nüchterne Genauigkeit ist wohltuend. Und dergestalt differenziert Tadovic so etwas wie zwei konkurrierende, sich aber gegenseitig bedingende Systeme aus: einerseits die kalte Mitleidlosigkeit des Gesundheitswesens, bei der nur Regeln befolgt werden, andererseits die verlässliche, aber trotzdem immer dankbar angenommene Hilfsbereitschaft im Dorf. Hier stehen alle Türen offen, dort schlägt man sie den Bittstellern verlässlich vor der Nase zu.

Aber die Unterwerfungsgeste des Regisseurs, sich ganz und gar der simplen Darstellung einer Handlungskette aus Sicht der Figuren zu verschreiben, macht Aus dem Leben eines Schrottsammlers zu einem politisch geradezu wirkungslosen Film. So gut wie keine Szene bekommt genügend Dauer, um den Zuschauer in ernste Unruhe zu versetzen, stattdessen verhandelt die Montage alles viel zu schnell. So wird die Wirklichkeitsättigung der Bilder von einer falschen Zeitgestaltung ausgehebelt: Die Entbehrungen der Armut sind nicht spürbar, wenn sie als Einzelstationen flott abgehandelt werden. Einmal allein lässt sich der Film Zeit und beobachtet Nazif, wie er an einem vereisten Steilhang nach ein paar Fetzen Altmetall sucht. Und an zwei gut platzierten Momenten werden Autos mit Äxten, Knüppeln und vor allem Muskelkraft zerlegt, was Aggression und Produktion als die beiden gleich wirksamen Dimensionen des einen Kämpfens gegen Armut darstellt. In diesen wenigen Momenten geht uns Nazif, als Filmfigur wie als Angehöriger einer ungerechten Welt, wirklich etwas an. Aber ansonsten bleibt es, trotz eines spürbar gutwilligen Humanismus, bei verkürzten Clashs von inszenierter Filmerzählung und echter Dokumentation, die zweierlei Ansprüche erheben, aber keinen zu befriedigen vermögen.
Neue Kritiken

Winter in Sokcho

Die Spalte

Hamnet

Die Stimme von Hind Rajab
Trailer zu „Aus dem Leben eines Schrottsammlers“



Trailer ansehen (3)
Bilder




zur Galerie (7 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.