All the Beauty and the Bloodshed – Kritik
Nach dem Edward-Snowden-Porträt Citizenfour führt Laura Poitras auch mit Nan Goldin einen Dialog im öffentlichen Raum. All the Beauty and the Bloodshed ist ein so bildgewaltiger wie intimer Dokumentarfilm über eine Frau, die nicht zulässt, dass ihr Leben und Leiden ins Private zurückgedrängt wird.

Die Geschichte von Nan Goldin, der sich Laura Poitras neuestes dokumentarisches Porträt widmet, ist eine Lebens- und Leidensgeschichte, die in Teilen sicherlich geläufig klingt. Eine blutjunge Frau zieht in den 1970er Jahren in den Big Apple und wirft sich in die Underground-Szene der Stadt. Die leibliche Familie wird abgestoßen, die Wahlfamilie angenommen, es folgen Eskapaden durch Kunst- und Nachtleben mit bekannten Namen aus der neueren Kulturgeschichte und der eine oder andere ausufernde Drogen-Exzess.
Dass diese Geschichte schon oft erzählt wurde, bemerkt auch Goldin irgendwann selbstironisch im Voice-over. Und doch schafft es Poitras, die nur allzu bekannte Selbstfindungsreise durch das New Yorker Underground-Milieu des späten 20. Jahrhunderts zu einer einzigartigen Geschichte zu machen. Diese Einzigartigkeit verdankt sie vor allem Goldin selbst, die in All the Beauty and the Bloodshed auf berührende Weise Zeugnis ablegt.
Epische Bildgewalt

Am Anfang von All the Beauty and the Bloodshed stehen nicht etwa Goldins Geburt und ihre ersten Lebensjahre in einem klassischen Einfamilienhaus in Washington D.C.. Stattdessen beginnt Poitras ihr Porträt der heute 70-jährigen Künstlerin und Aktivistin im März 2018 vor den Stufen des Metropolitan Museum in New York. Die Kamera folgt gebannt der Masse und die Masse folgt ebenso gebannt Nan Goldin, die einer Protestgruppe letzte motivierende Worte zuspricht. Das Ziel der Gruppe um die kleine Frau mit den roten Locken ist klar: der Sackler Wing des Metropolitan Museums an, gestiftet von jener mittlerweile berüchtigten Familie, die mit dem Vertrieb des Medikaments OxyContin seit 1995 Milliarden scheffelte und 400.000 Menschen in den Tod trieb. Untermalt von fast sakral klingenden Streichern wird die andächtige Stimmung in den Museumsräumen von durch die Luft fliegenden Pillendosen und Parolen niedergemäht, bevor der Titel des Films als Klimax erscheint. Der Prolog ist ein stimmiger Vorgeschmack auf die folgende Inszenierung von Goldins Kampf gegen die Pharmafamilie, den Poitras nicht selten mit einer epischen Bildgewalt untermalt.
Die etwas suggestive Inszenierung von Goldins heutigem Aktivismus wird ausgeglichen durch den zweiten Handlungsstrang, der Goldins bewegtes Leben durch den Blick auf ihr künstlerisches Schaffen der letzten Jahrzehnte nacherzählt. Diese Parallelhandlung zeichnet sich durch einen fast vollständigen Verzicht auf musikalische Untermalung und wenig Bewegtbild aus. Stattdessen lässt Poitras zu, dass Nan Goldin ihre Lebensgeschichte über ein Voice-over strukturiert, das mit dem passenden analogen Bildmaterial bestückt wird. Statt eine chronologische Stringenz zu etablieren, werden die beiden Handlungsstränge fragmentiert und nebeneinandergestellt. Dass Poitras das Schaffen der Künstlerin in der Vergangenheit und ihren Kampf gegen die Sackler Familie heute miteinander verwebt, ist ein inszenatorischer Kniff, den Goldin auch selbst in ihrer Person widerspiegelt.
Zuhören angebracht

Denn ihre Motivation, die Pharma-Familie zu Fall zu bringen, ist ohne Frage auch eine persönliche. 2017 gab Goldin erstmals öffentlich an, selbst eine OxyContin-Abhängigkeit überwunden zu haben, woraufhin sie die Kampagne Prescription Addiction Intervention Now ins Leben rief. Die NGO, kurz P.A.I.N. genannt, setzt sich seitdem mit öffentlichen Kampagnen, etwa dem Protest im Metropolitan Museum, für den Sturz der Sacklers und ihrer Opioide ein. „It’s not about my addiction“, stellt Goldin zwar im Hinblick auf die Arbeit ihrer Organisation klar, doch so ganz lässt sich ihr Aktivismus von den Sacklers nicht trennen. Denn die Familie, die sich seit Jahrzenten als große Philanthrop*innen mit Herzen aus Gold brüsten, schütten fast ebenso lang schon ihre Millionen auf eben jene weltbekannten Museen, die sich mit Goldins Kunst and ihre Wänden schmücken wollen. Die Künstlerin ist also sowohl durch ihre Kunst als auch durch ihre eigene Abhängigkeitsgeschichte mit den Sacklers eng vernetzt – ein Netz, aus dem sie sich lautstark freistrampelt.
Poitras lässt ihr Subjekt für den Großteil der Laufzeit fast völlig frei Zeugnis ablegen und fängt den über zwei Jahre geführten Dialog der beiden Frauen ein. Was entsteht, ist ein intimes Gespräch, bei dem sich das Zuhören in keinem Moment unangebracht fühlt. Denn Nan Goldin vermag es wie keine andere, die Intimität, die andere ihrer Kunst über die Jahre zugeschrieben haben, nach außen zu schreien und sie zu everybody’s business zu machen. Sei es ihr Leben als queere Frau, ihr Kampf mit einer Heroinsucht in den 1980er Jahren oder ihre Erfahrungen mit häuslicher Gewalt: Goldin lässt nicht zu, dass ihr Leiden in einen privaten Raum zurückgedrängt wird. Durch das öffentliche Präsentieren der Fotostrecken legt Goldin seit Jahrzehnten ihr Leben und das ihrer Freund*innen in all der Schönheit wie Brutalität offen. Ihre filmische Biografie tut ihr das gleich, und Poitras versteht es, über das Abbilden von Goldins Kunst einen Zugang zu ihrer Person zu ermöglichen.
Vom Porträt zur Hommage

Im Stil der Goldin’schen Diashows gestaltet auch Poitras ihre Bilder. Begleitet durch die Anekdoten der Künstlerin reiht sie Fotografien aneinander und findet zu jeder Person, jedem Ort und jedem Gegenstand, der besprochen wird, die passende Aufnahme aus Goldins Katalog. Die heutigen Aufnahmen von Goldins Aktivismus werden dagegen nicht mit weiterem Archivmaterial oder Fotokunst illustriert.
Aus jedem Bild, das Poitras auswählt, sprießt die Lebendigkeit, sei es eine Analogfotografie aus Goldins durchtriebenen Jahren in New York oder eine Aufnahme der zahlreichen Proteste in Museumsräumen. Einzig wenn es um die Sackler Familie geht, entzieht All the Beauty and the Bloodshed dem Bild diese Lebendigkeit und lässt durch das Einblenden der leerstehenden und leblosen Sackler-Ausstellungsräume eine unheimliche Ruhe einkehren. Goldin erzählt hier selbstbestimmt ihre Biografie nach eigenem Empfinden und Laura Poitras tritt in den Hintergrund, überträgt das Gesagte brav auf die Bildebene. So erlaubt sie der Künstlerin, aus dem Porträt, das eigentlich ihr gelten soll, eine Hommage zu machen an all die Menschen, die Goldin über die Jahre erlebt und verloren hat und die heute ihre Fotografien zieren.
Neue Kritiken

The Housemaid - Wenn sie wüsste

Madame Kika

Plainclothes

28 Years Later: The Bone Temple
Trailer zu „All the Beauty and the Bloodshed“

Trailer ansehen (1)
Bilder

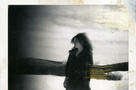


zur Galerie (11 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.









