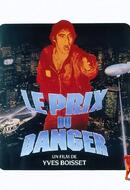Die Erbinnen – Kritik
Zur Einfühlung verdonnert – Die Erbinnen erzählt die Geschichte eines verspäteten Erwachsenwerdens, verlässt sich dabei aber allzu sehr auf die Wirkungsmacht eines reglosen Gesichts.

Die Erbinnen (Las herederas) erzählt vom Erwachsenwerden eines Menschen, der die mutmaßliche Mitte seines Lebens bereits weit überschritten hat. Zum ersten Mal seit vielen Jahren ist Chela (Ana Brun) ganz auf sich allein gestellt. Ihre langjährige Lebenspartnerin Chiquita (Margarita Irún) musste wegen nicht gezahlten Schulden ins Gefängnis und kann daher nicht mehr dafür sorgen, dass Chela das Frühstück auf korrekte Weise serviert wird oder dass sie auch ja ihre Medizin zur richtigen Stunde einnimmt. Chela muss nun, als wäre es das allererste Mal, Verantwortung für ihr Leben, für ihre Wünsche und ihr Verlangen übernehmen. Dabei durchläuft sie in Marcelo Martinessis Film alle klassischen Stationen der Reifung, wie es anderswo vornehmlich Highschool-Jugendliche in amerikanischen Vorstädten tun: Sie findet eine eigene Arbeit, sie verliebt sich, sie steht hilflos dem Drängen des eigenen körperlichen Begehrens gegenüber, sie lernt sogar das Rauchen. Dieses gänzlich unerwartete späte Coming-of-age ist aber in Die Erbinnen keine freudige Entfaltung bislang ungekannter Fähigkeiten, sondern von einem ganz eigentümlichen Schmerz geprägt: etwas nachholen zu müssen, was man eigentlich schon hinter sich glaubte und wozu man vielleicht gar nicht mehr in der Lage ist.
Ein wohlfeiles Gefühl der Nähe

Auf visueller Ebene vertraut Die Erbinnen dabei vornehmlich auf die Wirkung von Chelas ganz in sich versunkenem, melancholischem Blick. Genauer gesagt: Der Film vertraut auf einen Prozess, den dieser Blick fast zwingend notwendig in Gang setzt, einen Prozess der Annäherung, des Versinkens und der unbewussten Vervollständigung. Die geschwungenen Linien und geometrischen Formen von Chelas Gesicht werden beim Betrachten fast unweigerlich mit einer Innerlichkeit ausgestattet, die unbegrenzt zugänglich und verständlich erscheint. So entsteht eine plötzliche Erfahrung der Nähe von der Art, wie sie zu den grundlegenden Wirkungen des Kinos gehört – denn gerade eine solche Erfahrung der Annäherung an ein fremdes Erleben kann hier viel unmittelbarer und mit größerer Vehemenz hervorgebracht werden als in jeder anderen Kunstform, ja als in unserem alltäglichen Erleben.
Doch Die Erbinnen verlässt sich allzu sehr auf diese Hausmacht des Kinos, baut über weite Strecken fast gänzlich auf diese Art der unwillkürlichen Einfühlung, deren Wirkung, wenn man sie zu allzu oft in Anschlag bringt, schnell zu einem mechanischen Affekt wird. So konstruiert der Film zwar eine Vielzahl dramatischer Situationen, doch gestaltet er sie nie wirklich aus, verkompliziert und entwickelt sie nicht, sondern flüchtet sich allzu schnell in den Anblick von Chelas regungslosen Gesichtszügen, die ganz allein der jeweiligen Szene ihre Sinnhaftigkeit und ihre emotionale Wucht verleihen sollen. Dabei vergisst der Film, dass jede Verbundenheit zu einem fremden Wesen immer auch ein Bewusstsein für das Trennende miteinschließen muss. Die ruhig beobachtenden Nahaufnahmen, in denen Chela etwa stumm den Verkauf der Erbstücke ihres Vaters verfolgt oder voll Angst zum ersten Mal ein Auto steuert – sie lassen in Martinessis Film somit zwar ein Gefühl der Nähe entstehen, doch wird diesem Gefühl nie abverlangt, dass es der individuellen Ausprägung einer fremden Persönlichkeit Rechnung trägt oder einen nicht zu tilgenden Rest an Unzugänglichkeit in sich aufnimmt. Die gefühlte Nähe wirkt, als wäre sie ganz unmittelbar, doch tut sie das nur, weil sie in Wahrheit schlicht beliebig ist.
Liebevolle Entmündigung

So ist die interessanteste Entwicklung in Die Erbinnen dann doch nicht Chelas zukunftsgewandter Reifungsprozess, sondern die rückwirkende Umwertung ihrer eheartigen Beziehung zu Chiquita. Denn deren Fürsorge, die am Anfang noch als Ausdruck selbstloser Zuneigung und zwangloser Intimität erscheint, wird im Laufe des Films mehr und mehr als eine über Jahre gewachsene Entmündigung der Umsorgten erkennbar. Was umso tragischer ist, als sich diese Entmündigung scheinbar ganz ohne offenkundig bösartige Absichten vollzog, sondern sich vielmehr aus der inneren Dynamik der Liebe selbst ergab. Denn schließlich hat man in jeder Liebesbeziehung das Bedürfnis, vom anderen gebraucht zu werden, für ihn da zu sein, ihm Gutes zu tun – und dieses Bedürfnis kann nur dann befriedigt werden, wenn einem der andere Gelegenheit dazu gibt, wenn er nicht vollkommen selbstständig ist, wenn er bis zu einem gewissen Grade hilflos ist. So ist Die Erbinnen zwar die Schilderung einer nachgeholten Reifung, doch den dunklen Kern des Films bildet das, was dieses Nachholen überhaupt notwendig gemacht hat: eine Liebe, deren Geborgenheit zur Bedrohung geworden ist, die nicht Schutz bietet, sondern die eigene Überlebensfähigkeit beharrlich erodiert.
Neue Kritiken

Kopfjagd - Preis der Angst

Knives Out 3: Wake Up Dead Man

Gavagai

Stille Beobachter
Trailer zu „Die Erbinnen“



Trailer ansehen (3)
Bilder




zur Galerie (5 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.