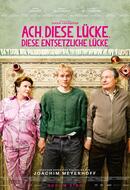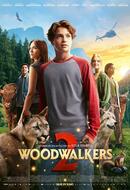12 Tage – Kritik
In 12 Tage klagt der große französische Dokumentarist Raymond Depardon die Zwangsinternierung psychisch Kranker an. Dabei vertraut er auf die geheimnisvollen Kräfte des Films, Sprachen jenseits der Worte zu finden.

Wir wissen nichts über sie, bis wir sie das erste Mal sehen. Keine Namen, keine Biografien, keine Krankengeschichten. Die Internierten von 12 Tage (12 jours) erscheinen vor der Richterin und damit im Bild. Die Kamera ist schon da, hat sie bereits erwartet im fahlgrauen Vernehmungssaal. Sie schlurfen durch die Tür, setzen sich in den Kader. Eine halbnahe Einstellung. Wir sehen sie fast frontal von vorne. Der Gegenschnitt auf die Richterin ist weiter kadriert und stärker seitlich aufgenommen; distanzierter, skeptischer, leicht entrückt. Raymond Depardon baut den Großteil seines Filmes aus diesen beiden unbewegten Einstellungen. Patient versus Richter. Ein Duell, aber ein ungleiches.
Ein abgekartetes Spiel

Ein einleitender Text hat uns informiert: Wer in Frankreich gegen seinen Willen psychiatrisch interniert wird, hat nach 12 Tagen Anspruch auf eine richterliche Überprüfung. Dort wird beschieden, ob die Behandlung (ein gebräuchlicher Euphemismus) fortgesetzt wird. Wenn ja, wird die Prozedur alle sechs Monate wiederholt, potenziell für immer. Ein halbes Dutzend solcher Anhörungen zeigt uns Depardon, mit neu eingewiesenen Patienten und langjährigen Insassen. Vorsicht Spoiler: Kein einziger Patient will im Krankenhaus bleiben. Und kein einziger wird freigesetzt.
Es ist eben ein abgekartetes Spiel: Die entgleisten Schicksale, die sich aus den Patientenaussagen erahnen lassen, die von Psychopharmaka sedierten Augen, die umherirrenden Sätze, all das passt nicht ins Normengefüge von Recht und Medizin. Sie halten sich nicht an die Regeln von Logik, Kohärenz, Folgsamkeit. Und doch halten sie uns den Spiegel vor. Denn in jeder der verhandelten Geschichten kann man Ängste unserer Zeit wiedererkennen. Ein junger Mann fühlt sich von Terroristen verfolgt, eine Frau drehte durch, weil sie gemobbt wurde. All das, was die Menschen hier in den Augen der Macht hat verrückt werden lassen, wabert durch unsere gesellschaftliche Atmosphäre. Wir könnten ebenso gut dort sitzen.
Das geheime Gespräch der Blicke

Ein Hauch dieses Wissens scheint auch die Richter – wir lernen drei oder vier verschiedene kennen – anzuwehen. Sie sind mitnichten kalte Agenten staatlicher Macht, sondern oft sichtlich angefasst von dem, was sie hören, und ihnen ist unwohl bei dem, was sie tun müssen. Eine Patientin erklärt unaufgeregt, dass sie unglücklich sei und sich umbringen wolle. Ihre Erklärung ist sachlich, verständlich aufgebaut, vernünftig argumentiert. Nichts daran ist verrückt. Die Richterin kommt ins Stottern: „Ich weiß jetzt nicht, ob das Recht verbietet, dass Sie sich umbringen …“ Und zieht sich dann zurück auf die Position, die sie alle letztlich ergreifen: In der Krankenakte haben die Ärzte vermerkt, dass die Behandlung fort- und die Frau weiter fest gesetzt werden soll, es bestünde Gefahr für sich und andere. Die Medizin tut sich nicht schwer mit dem präventiven Urteilen, wie es im Strafrecht weiter hoch umstritten ist.
Doch meistens scheitern die Insassen an der offiziellen Sprache. Ihr Denken entrückt die Normen, die Medikamente haben sie mürbe gemacht. Was sie sagen, wird deshalb meistens nicht gehört. Einer Frau beschwert sich unter Tränen, dass sie von zehn Pflegern niedergerungen worden sei. Der Richter sagt vage, dass so was manchmal nötig sei. Immer sind die Patienten unterlegen.
Doch jenseits der Worte gibt es noch ein zweites, ein geheimes, ein parallel stattfindendes Gespräch, eines, bei dem die Karten gerechter verteilt sind, bei dem sich Gleich und Gleich begegnen. Es ist das filmische Duell der Blicke. Die Insassen suchen meist den Augenkontakt der Richter, flehen, bitten, bedrängen stumm. Und die Richter, sie weichen immer wieder aus, können nicht standhalten, schlagen die Augen nieder zu den Papieren auf dem Tisch. Da, wo die Sprache ihnen Sicherheit gibt und Souveränität. Die Blickdialoge konterkarieren die verbalen Gespräche, kehren sie gar in ihr Gegenteil um. Die oft mäandernden Berichte der Patienten bekommen auf einmal Seele und Sinn, während die Macht der richterlichen Sprache ins Straucheln kommt, sich versteckt. Im schlichten Schuss- Gegenschuss von 12 Tage wird ein alter Traum des Kinos sichtbar: eine Sprache jenseits der Worte zu finden, eine, die universal verständlich ist, die alle sprechen können.
Statische Bilder, bewegte Gefühle

Aber jede Sprache bietet Möglichkeiten zur Lüge, zum Betrug. Ein Insasse bittet inständig, fast flehentlich darum, dass man Kontakt mit seinem Vater aufnähme. Seine Augen schauen gerade heraus. Es scheint ihm wichtig zu sein. Nachdem er das Zimmer verlassen hat, sagt die Richterin aus dem Off: „Für den Kontext: Er hat seinen Vater umgebracht.“ Und wieder merken wir, dass wir die Personen nicht kennen, dass die formale Beschränkung des Films einiges deutlich zutage treten lässt und anderes verunklart. Dass Depardon diese Lückenhaftigkeit sichtbar macht, zeichnet 12 Tage aus. Bei aller Sympathie für die Insassen, bei aller David-vs.-Goliath-Haftigkeit der Duelle, die uns instinktiv Partei für die strukturell Unterlegenen ergreifen lässt, bleibt der Film ambivalent, observiert mehr, als dass er festlegt, stellt eher Fragen, als dass er Thesen schwingt. Was unterscheidet den erzwungenen Krankenhausaufenthalt vom Gefängnis? Und von der Untersuchungshaft? Welchen Platz hat Empathie in der Medizin? Und welchen das Recht?
Und doch: 12 Tage ist letztlich eine stille Anklage. Zwischen die Gerichtsszenen mischt Depardon triste winterliche Impressionen aus der Anstalt. Eine Welt aus verschlossenen Türen, endlosen Gängen, Zäunen und Mauern; verstellte Blicke, beschränkte Bewegung. Im steten Wechsel aus hoffnungsarmen Ansichten und erschütternden Anhörungen verdichtet sich der Schnitt allmählich zu einem Argument gegen die Zwangsinternierung – ein starkes Argument, das allein durch den unerheblichen, Satie-haften Klavierscore Alexandre Desplats etwas entkräftet wird.

Es bleibt unzweifelhaft, dass Depardon an den Insassen und ihren Schicksalen gelegen ist. So rigide und strukturell stringent der Film aufgebaut ist, so mitfühlend und geduldig verhält er sich gegenüber seinen Protagonisten. Die statische Kamera bewahrt respektvoll Distanz, die ruhige Montage will nicht vereinfachen. Wie geheimnisvoll sind doch die Verbindung von Film- und Gefühlsbewegung: Gerade weil wir einen sicheren, festen Standpunkt haben, gerade weil die Abläufe so festgefügt sind, können uns die stets unerwartet verlaufenden Geschichten und die Figuren mitreißen. Vielleicht kann man das an einem Vergleich gut illustrieren: Formal ist 12 Tage das Gegenteil zu Wang Bings Till Madness Do Us Part, wo die Kamera sich ganz und gar mit den Insassen einer Psychiatrie gemein macht, ihre Bewegungen die Bewegungen der Figuren aufgreift und fortführt. Und doch verbindet beide Arbeiten vieles. Denn die eine wie die andere schafft es, durch die einzigartigen Verfremdungsfähigkeiten des Films – unbändige Bewegtheit hier und unerschütterliche Ruhe da – die un-normale Sprache der scheinbar Irren in eine allgemeinverständliche Sprache des Zuschauens und Zuhörens zu übersetzen und sie damit ein wenig verständlicher zu machen.
Neue Kritiken

Die Spalte

Hamnet

Die Stimme von Hind Rajab

The Housemaid - Wenn sie wüsste
Trailer zu „12 Tage“


Trailer ansehen (2)
Bilder




zur Galerie (12 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.