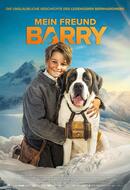Auf der Adamant – Kritik
VoD: In seinem, dieses Jahr mit dem Goldenen Bären der Berlinale ausgezeichneten Dokumentarfilm erkundet Nicolas Philiberts eine auf der Seine schwimmende psychiatrische Tagesklinik.

Das Adamant öffnet sich am Morgen, öffnet seine Türen und Fenster, öffnet seine Holzschotten, wie Augen, die langsam aus dem Schlaf erwachen, öffnet sich am Anfang von Nicolas Philiberts neuem Dokumentarfilm On the Adamant (Sur l’Adamant), öffnet sich für diejenigen, denen oft gesellschaftliche Teilhabe verschlossen bleibt, die hierherkommen wollen, um sich selbst zu öffnen, rauszulassen, was im Kopf so herumschwirrt: welche Sorgen, Gedanken, Assoziationen, Songs, Bilder, Geschichten, Wünsche. Und Philibert öffnet uns einen Zugang zu dieser Tagesklinik, die als Schiff auf der Seine in Paris ankert. Wobei räumliche Klarheit nicht unbedingt die Sache des Films ist, für den dieser Ort eben nicht aus Bug und Heck, Steuerbord und Backbord, Holzplanken und Glas, sondern jenen Menschen besteht, die ihn Tag für Tag beleben.

Menschen, die in Philiberts Film gar nicht immer so leicht in Patienten und Pfleger und Therapeuten geschieden werden können, ohne dass diese Aufteilung dann doch komplett in sich zusammenfällt. Womit das zentrale Prinzip des Adamant aufgegriffen wird: Jede Woche beginnt mit einer Versammlung, die von Patient und Mitarbeiter geleitet wird. Die Neuen werden begrüßt, besprochen, was gestern war, was morgen kommen soll, übersetzt werden die Ideen in Workshops, für die das Adamant immer das passende Zimmer, die richtigen Mittel parat zu haben scheint. So kann man sich hier ausdrücken, von dem Gedanken an Schlumpfmützen erzählen, die irgendwie auch immer mit Püree zusammenhängen, eine Gottesanbeterin malen, die sich für Dinner und Date schick gemacht hat, „Wim Wenders, diesen Halunken“ beschimpfen, weil er das eigene Leben für Paris, Texas als Stoff geklaut hat, ein Filmfestival organisieren und vor allem: immer wieder über all das reden, sich mitteilen, eine Zuhörerschaft bekommen, selbst zuhören und ernst genommen werden, wenn das, was ausgedrückt werden soll, noch ein bisschen Hilfe braucht, eine verständliche Form anzunehmen.
Einschreiben und überschreiben

Die Metafrage des Films: Wie wird er mit seinem Blick auf eine Psychiatrie und ihre Patienten umgehen? Wie markiert der Film sein Wissen um diese unweigerliche Frage? Die Antwort darauf erkundet weniger der Regisseur, als es die Menschen vor der Kamera tun, wenn sie eben darüber reflektieren, vor der Kamera zu sein, erwähnen, dass sie hier wohl alle zu Schauspielern werden, oder gerade nicht für die Kamera performen, sondern direkt entlarven, dass hinter ihr noch ein Regisseur steht, der genauso mal von sich und seinen Haustieren erzählen könnte, wenn er denn schon mal hier ist. Philibert erkundet dafür auf eigene Faust, was eine nachträgliche Schrifttafel mit einer 109-minütigen Filmerfahrung machen kann, wenn er sich abschließend selbst einschreibt mit einer Nachricht, die das Gesehene sogar überschreibt. Die über eine aufs „Kästchen-Ankreuzen beschränkte“ Welt spricht, während es diese Welt des Films ist, in der noch „echte Individuen“ leben. Die verwaltete Gesellschaft ist kein Geheimnis mehr, aber die Patienten des Adamant kurzerhand aus ihr auszugliedern unterläuft entweder die Arbeit, die dieser Ort leistet, ist falsche Romantik oder eben beides. Es ist einer der wenigen Gedanken des Films, die sich mir verschließen.
Der Film steht bis 12.03.2025 in der 3Sat-Mediathek.
Der Text erschien ursprünglich am 24.02.2023
Neue Kritiken

No Bears

Scarlet

Marty Supreme

Father Mother Sister Brother
Trailer zu „Auf der Adamant“


Trailer ansehen (2)
Bilder




zur Galerie (11 Bilder)
Neue Trailer
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.